Entfesselte Stürmerei
Gestern wollten die schweizerischen Parlamentarier die Arbeit niederlegen, um in die Ferne zu sehen, in die Republik Südafrika. Darüber wurde von den direktesten aller Demokraten abgestimmt. Heraus kam dabei: Weiterarbeiten! Worauf Anarchie oder auch Revolution ausbrach unter Burgern und Bürgern. Man ließ die Gesetzgebung sozusagen links liegen und eilte ins Fernsehzimmer. Dort schoß nämlich einer, der ansonsten etwas anders geartet ist als seine Landsleute, selbige in den Himmel. Man möchte ein Kreuz aus Asche machen über diese Schweizer.
Revolution gab es dort allerdings schon einmal, zumindest im welschen Teil des Landes. Vermutlich lag es am Französischen, das dort gesprochen wird, möglicherweise auch daran, weil auf der anderen Seite des Röstigrabens ganz gerne mal ein wenig nach Nordwesten geschielt wird. Im Genève der frühen Siebziger ging man jedenfalls auch auf die Barrikaden — monter au créneau —, wie weiland der Rote Dany, als der Strand noch unterm Pflaster lag und bevor er die Partyfront entdeckte und dabei ganz grün wurde. Daraus ergab sich unter anderem auch das, was als Emanzipation in den Sprachgebrauch eingegangen ist und heutzutage häufig leicht mißverständlich gebraucht wird. Mein Bauch gehört mir hatte zu dieser Zeit sozusagen eine etwas tiefergehende Bedeutung.
«Nachgeborene können sich das nur noch schwer vorstellen», stimme ich der Besprechung bei TopTV zu, die einige inhaltliche wie sprachliche Ungereimheiten birgt, aber es im wesentlichen erfaßt: «Auch die Schweiz [...] hatte mit den sozialen Korrekturvorschlägen enthemmter Studenten zu kämpfen. Von wegen Abtreibung, Gleichberechtigung, Dehierarchisierung, freie Liebe und so weiter. [...] Serge Gainsbourg, den wilden Pariser Chansonnier, kennt man beispielsweise auch außerhalb Frankreichs. Dass aber ausgerechnet der erotomanische Skandalier (Je t'aime!) und Frauenheld mit der neuen Minirockmode so seine Schwierigkeiten hatte, das verblüfft auch die junge Genfer Studentin Lucie [...], die gerade beim Fernsehpraktikum dokumentarisches Material aus den 60-ern auswertet. Viel entscheidender ist aber ein anderer Filmschnipsel aus jenen bewegten Tagen, auf dem das 19-jährige Mädchen ihr Ebenbild erkennt: eine feministische Studentenaktivistin, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten scheint.» Letzteres stimmt so nicht, denn es ist ein ebenso junger, ihr recht zugeneigter Kollege, der vom Teint her dem oben verlinkten ähnelt, der auf dem Bildschirm eine verblüffende Ähnlichkeit feststellt.
Die junge Frau wird etwas später noch einmal daran erinnert und spricht ihre in einer gänzlich anderen, möglicherweise einer gestrigen Welt lebende Großmutter daraufhin an. Die antwortet geradezu verzückt lächelnd mit «Ach, mein liebes Geschenk»; es konnte aber auch mein Liebesgeschenk geheißen haben, eine Assoziation, die sich im Film erst später anbietet, wenn die Zusammenhänge klarwerden, wenn sich herausstellt, daß Leihmütter möglicherweise eine Erfindung der Frauenbewegung waren. «Lucies mysteriöse Doppelgängerin heißt Geneviève», so weiter im Text von TopTV, «[...] Offenbar hat die Familie den Platz der studentenbewegten Phantomfrau aus der Ahnengalerie gestrichen. ‹Eine gefährliche, drogensüchtige Anarchistin› sei Geneviève gewesen, so versichert es der Opa seiner gleichfalls ahnungslosen Tochter [der Mutter von Lucie]: ‹Wir haben dich gerettet.› War Geneviève gar bei der RAF?» Nein. Eher in der Kommune von Otto Muehl, deren «reichianischen» Urschreie kurz durch das alte Filmmaterial im neuen gellen.
arte wiederholt den Film, dessen Originaltitel Déchaînées lautet, was gleichermaßen mit entfesselt oder auch stürmisch (in weiblicher Form) übersetzt werden kann und deutschsprachlich als Frau und frei frauenillustrig verkümmert, am 24. Juni um ein Uhr in der Früh, wenn im Fernseher garantiert niemand mehr kickt und vermutlich auch niemand mehr Gesetze ändern muß.
Ich komme darauf, da Eva Lirot das Thema angetippt, das sich bei mir jedoch erweitert hat, da ich immer wieder mal mit Kopfschütteln bedacht werde, wenn ich den ganz Jungen aus der Zeit erzähle, in der es hieß Wer einmal mit derselben pennt, gehört schon zum Establisment — wobei es hier wohl heißen muß, wer einmal mit demselben —, aus dem sich etwas später die Singelei entwickeln sollte, die heutzutage nichts anderes mehr bedeutet als Sehnsucht nach Zweisamkeit. Vor allem aber geht es in diesem Film nicht alleine um die Freiheit der oder durch die Sexualität. Es sind gesellschaftliche Werte, die als die ganz alten sich wieder Bahn durch die neueren zu brechen versuchen, oder letztgenannte, die mittlerweile häufig unfreiwillig in ein Dasein als Alleinerziehende münden oder dort gar enden. Die Konfrontation ist es, die dieser Film in Bild und Wort, sowohl in Darstellung als auch in Regie herausragend zeigt, das Aufeinanderprallen der althergebrachten Lebensform Familie, Vater, Mutter, Kind mit der der «alleinstehenden», kämpferischen Mutter, die zu ihren Eltern (in etwa) sagt: Er ist nicht mein Gefährte, er ist mein Liebhaber, ich bügle ihm nicht seine Hemden.
Das im Film gezeigte historische Bildmaterial stellt sich dabei als dramaturgischer Kniff heraus, da es nicht nur zeitlich die verschiedenen Ebenen verdeutlicht. Ein weiterer schweizerischer Filmemacher drängt sich dabei auf: Alain Tanner. Er hat mit Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 insofern bereits (Film-)Geschichte geschrieben, als er schon 1976 das Ende der großen Revolution andeutete, das Ende der Barrikadenkämpfe und der Rückzug ins Private, auf ein bäuerliches Anwesen, wo der rundliche und schüchterne Protagonist sich zum Geburtstag eine sexuelle Tollheit wünscht: mit zwei Frauen schlafen zu dürfen. Inmitten von braun und blond (in Gestalt der zauberhaften Miou-Miou) wird ihm sein Wunsch gewährt. Der im Jahr 2000 fünfundzwanzig Jahre alte Jonas lebt bei Tanner dann in einer Zweierbeziehung mit einer Afrikanerin und träumt als Filmer davon, Müll zu zeigen. — Aber meine Empfehlung ist alles andere! Die ist hervorragendes Kino, aktuell und aufklärend, aber durchaus unterhaltsam, für Zwanzig- bis Vierzigjährige. Drüber oder auch einiges drunter geht ebenfalls, denn es geht keineswegs in der Weise hin und her, daß die Sittenpolizei angerufen werden müßte, auf daß sie ein Stop-Schild anbringe.
Also: am 23. Juni beginnt das Spiel Deutschland gegen Ghana um 20.30 Uhr, ist demnach längst zuende, wenn dieser sehenswerte Film gesendet wird. Die Schweiz wird wohl am 21. beerdigt werden. Und ich werde vermutlich bereits heute Abend Asche über Les Bleus gestreut haben.
| Do, 17.06.2010 | link | (2566) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |
Bitte um Hilfe!
Jemand hat offensichtlich meinen nachstehenden Beitrag Olga, die Gräfin und die Sprache bei Face.book verlinkt, was zu einer nicht unerheblichen Klickerei geführt hat. Da mich interessiert, wie das zustandekam beziehungsweise wer das war, ich mich dort jedoch nicht anmelden möchte: Hat jemand ein Konto bei dieser Großgemeinde und kann mal — sofern es kein großer Aufwand ist — nachschauen, wer das war? Ich danke vorab.
| Do, 17.06.2010 | link | (1288) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Aktuelles und Akutes |
Olga, die Gräfin und die Sprache
Bei Aléa Torik las ich soeben eine zauberhafte Geschichte über ein Frauenfrühstück. Sie endet mit einer Absage an nationale Kulturen, Sprachen und Fußballmannschaften; schließlich gehe es auch ohne Männer. Die darin erwähnten Olga und der Wodka haben mich an etwas erinnert, das mir seinerzeit sprachlos endlich eine Heimat zuwies.
Eine Gräfin gab es (und gibt es vermutlich noch), die ich als abstammungsgemäß hoch und gerade aufgerichtete blondblauäugige preußische Dame mit entsprechend guten Manieren samt Ehemann und Kind kennengelernt hatte. Sie hatte sich einen auch mir bekannten Herrn zugelegt, einen nicht minder, aber gänzlich anders attraktiven Bulgaren mit einem Teil russischen Adelsblutes in sich, verheiratet mit einer Spanierin und Vater zweier niedlicher Töchter. Ihm war sie an den altaiischen Rand der Mongolei gefolgt, wo er einen Film drehen wollte über eine Gruppe von Künstlerkollegen. Begegnet war er denen in Moskau während eines alltäglich-fröhlichen Zusammenseins, das hierzulande vermutlich als grauenvolles Besäufnis gewertet würde. Etwa ein halbes Jahr später kamen die beiden zurück, um den Film über die Artisten sowie sie selbst und deren Kunst vorzustellen. Die Gräfin betätigte sich seit einiger Zeit als Galeristin, der Filmer hatte mich zu deren Stand auf einer internationalen Kunstschau gebeten, um mir das Ergebnis der monatelangen Dreharbeiten zu zeigen und mich den Kollegen vorzustellen.
Wie die Wächterin eines Großkolonialreiches stand die Dame vor dem Eingang zu ihrer temporären Galerie, ihre knapp ein Meter fünfundachtzig in Hüfthöhe leicht eingeknickt, in der rechten Hand eine Flasche russischen Wodkas, die sie nur kurz weggab, um anderen auch einen Schluck zu gönnen. Sie hatte in den Jurten der Mongolen das Trinken gelernt, vielleicht war es auch während des anschließenden Aufenthaltes in Moskau, so genau erinnere ich mich nicht mehr daran. Auf jeden Fall kreiste die Flasche, mit dem Erfolg der Verständigung. Die Künstler sprachen nämlich lediglich ein paar Brocken Französisch, und ich ebensolche Russisch (aber auch nur, wenn adäquater Spirit in mich gefahren war) oder was auch immer an Sprache zum Gespräch hätte beitragen können. Ich blieb dennoch die restlichen Stunden des Tages am Platz, und gemeinsam verbrachten wir anderenorts den Abend und die Nacht, zumal noch ein paar Damen aus dem Ural und Kasachstan sowie Usbekistan hinzugekommen waren, die ebenfalls Westkarriere zu machen sich vorgenommen hatten, jede wohl auf ihre Weise. Mit ihnen mischten sich Bruchstücke in unser babylonisches Gewirr, die sich nach Englisch anhörten, aber nicht weiter benötigt wurden.
In den frühen Morgenstunden stellte der beharrliche Kreis nach einer Frühstücksrunde reinen Wodkas, inganggesetzt vom kaum mehr wahrnehmbaren Augen-Blick eines dieser mongolischen Steppendiaten, einstimmig meine Herkunft fest — einer der ihren sei ich, mit Sicherheit unter freiem Himmel in die Welt geworfen, alleine an meiner trinkerischen Mentalität sowie meiner kauernden Haltung sei das ablesbar. Was mein Vater immerfort angestrebt hatte mit seinen schwärmerischen Erzählungen von der sibirischen Heimat, in der ich schließlich als Kleinkind einmal gewesen und die nicht zuletzt deshalb auch die meine sei, was von meiner Mutter aber immer abgetan oder gar niedergeredet worden war, dessen wurde mir also vor etwa fünfzehn Jahren dämmernd gewahr: Auch ich bin, Globalisierung hin oder her, einer von drüben, aus dem Osten.
Heimat gibt es auch ohne einheitliche Sprache. Hauptsache, es ist genügend Wodka da.
| Di, 15.06.2010 | link | (4298) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
Das Spiel reißt Lücken
in die Literatur, verzerrt die Perspektiven und nimmt alle Farbe aus dem Leben.
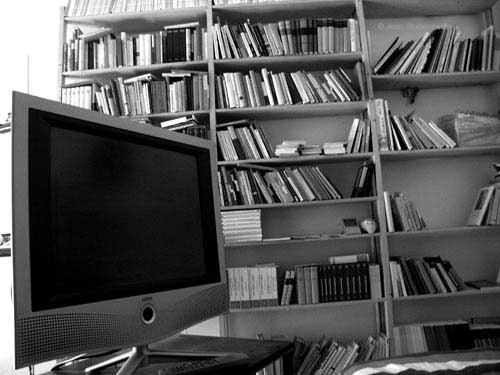
Seit der 1975 vom seinerzeit schon jenseitigen Walter Jens voller Würde, allerdings nicht minder emphatisch vorgetragenen, also unvergessenen Republikanischen Rede, mit der er den geladenen Gästen des Deutschen Fußballbunds zugleich die Leviten gelesen hat, die der akademischen Welt den Fußball, der etwa seit 1968 und bis zu diesem Vortrag nur heimlich betrachtet und gehört werden durfte wie die Gesangsdarbietungen auf dem frängischen Grünen Hügel, wieder zurückbrachte, ist es schließlich statthaft, sagen zu dürfen: «Wenn ich den letzten Goethe-Vers vergessen habe, werde ich den Eimsbütteler Sturm noch aufzählen können.» Für mich eher schlichteren Zeitgenossen, der früher fürs Mannschaftsspiel zudem einen Stock benötigte, gilt das zwar nicht unbedingt, da ich mir dieses erbarmungswürdige Geldgekicke schon lange nicht mehr anschaue. Aber zu einer Weltmeisterschaft, das sei eingestanden, schiebe auch ich meinen Widerwillen zur Seite und setze mich vor dieses Fenster zur Welt.
Und so kommt denn auch mal wieder die Erinnerung hoch:
«Der Lorbeer krönt den glücklichen Erwählten, der den Nihilismus überwindet, ohne je diesen hartnäckigen Gegner gering zu achten oder zu unterschätzen. Er ist ein Sieger, der den Preis des größten, weitreichendsten und radikalsten Zweifels zählt.»
Ja, jetzt verbiege ich André Glucksmann. Aber es geht schließlich um Weltbewegendes. Und mir ist auch nicht bekannt, ob sich der vor ein paar Jahren wegen der Tatsache Gescholtene, Nietzsche über den Klappentext hinaus gelesen zu haben, für Fußball erwärmen kann. Aber er, der die Gefühle der Grande Nation kennt wie Ex-Adidas et Olympique Marseille-Präsident Bernard Tapie en taule, dürfte das ja — seit dem Sturm auf das Stade-de-France von 1998 (der überdies die Front National von Le Pen, dieser französischen Version eines österreichischen Rassenfanatikers, einige Verluste gebracht hat).
Also weiter in der Ver-Biegung: Nietzsche meinte: «Was bedeutet Nihilismus? Daß die oberen Werte sich entwerten.» Und Glucksmann fragt: «Was sind diese so hoch plazierten Werte? Es sind die, die dem menschlichen Wesen in der Welt einen Platz zuweisen.»
Aber sicher doch: Unsere Individuen Super-Mario in der Bodega des madrilenischen Finanzathleten Gil y Gil oder Loddar aufm Soccerplatz in the middle of no-where, im Abseits das Töchterlein von Müller-Lüdenscheid, die, wäre sie eine mittelmeerliche Nymphe, gut für die Griechenland-Werbung im Leo-Fernsehen posieren könnte: »Menschen, die nach wahren Werten suchen.» Aber sie ist nunmal blond und blauäugig. Und Loddar kann nicht Griechisch. Deshalb geben wir die drei, Weißbier-Mario, sie und ihren intellektuellen Stuka-Piloten, weiter ins Fernsehstudio nach Berlin-Mitte und letzterem das Wort:
«Heude, zum zu Ende gehenden zwanzigsden Jahrhundert, inmidden der Legissladurperiode, haben wir doch endlich alles: Jeder kann sich ein auf ihn zugeschniddenes Dier zulegen (und leisden). Dafür haben wir in unseren hervorragend geschniddenen 30 Quadradmedern mit Balkonedde doch immer noch ein Blätzschen. Nadur? Schaun Sie sich um. Der ganze Spreewald hat Blatz für uns auf unsern Moundenbeigs, niemand bedrängt uns, wenn wir sonntags fulldrässd und auf unsern Inlinesgäids ins südbayrische Hinderland umsiedeln. Wer von diesen Malochern aus der sozialdemogradischen Steinzeid konnte denn, nach ein bißschen Ständ bei, mal eben zwischen zwei Schbielen — oder auch, als Studdi, zwei Semesdern — zum Sörfen auf die Bahamas düsen, zwischendrin sisch auf'm Dadenhaiwäi ne Hodlain Blaind Däids reinziehn und nebenher an der Börse nochn bißschen zoggen? Damals, diese Dauben- oder Kaninchenzüchder. Mit ihrn Barzellschen vorm Backschdeinhäuschen. Diese Malocher mit ihrm Ehrgefühl, mid ihrm ‹Glassenbewußdsein›. Wir sind die Glasse. Wir sind die wahren Werde. (Ganzler, sprischd man des mit oder ohne h?).» Mario: «Mit K, Du Bocksbeudel.»Ach, so lange ist es noch nicht her, als Ralph Köhnen im Laubacher Feuilleton kreiselte: »Fußball ist kommentarbedürftig wie abstrakte Kunst», und er charakterisierte, melancholisch-retrospektiv, das kompositorische Phänomen vergangener Zeiten, quasi in einem Ehrenbezeugungs-Suffix gegenüber dem Intellektuellen unter den deutschen Ballzauberern (jenem Conférencier, dessen TV-Suaden mittlerweile nicht minder kommentarbedürftig sind): «blitzschneller Flirt des Auges mit der Tiefe des Raumes».
Ja, unsere Jungakademiker durften wieder, nachdem der 68er den Fußball ins Abseits gebolzt und Ober-Rhetor Walter Jens ihn mit seiner fahnenschwingenden Apologie zum Geburtsag des DFB («... Versöhnung mitten im Streit») von 1975 wieder aufs Geviert gepredigt hatte. Und solches hatte er bewirkt: «Eine Textkultur des interpretatorischen Risikos ist gefordert: nicht sparsam zum Ziel zu kommen, sondern die Verschwendung, die Lust und den Plural zu riskieren als einen Umweg: als ein Abenteuer, das Leser und Text gleichermaßen zustößt», so der Jung-Rhetor 1991 in seinem Leid-Artikel, Günter Netzer oder der Diagonalpaß auch als Textkultur. Der Anglist, Germanist und Kunsthistoriker war es auch, der sich mit Sport-Sprech oder: Der Wontorra in uns allen um Moderation bemühte (sowie die schwatten Perlen vorab würdigte).
Nein, dies hier läutet keinen Abgesang auf Doctor Köhnens Sportkritik ein (befaßt er sich doch im folgenden mit einer weiteren olympischen Disziplin: den Biographien unserer Literaten). Es kündigt ein Hosiannah an: Der selige Karl Ruhrberg (von dem sich hartnäckig die Mär hält, wegen eines Fußballspiels seines kölnischen FC auch schon mal eine Ausstellungseröffnungslaudatio in seinem Ludwig-Museum an die Gattin delegiert zu haben) belegt, was uns bewegt: die Sportler und deren Ausflüge auf den Gipfel der Musen.
Allerdings: Den Lorbeer des Geistigen kennen wir. Er liegt täglich in unserer Gen-Suppe des Negierens (nicht von Eliten!). Wem aber der Kranz des Physischen geflochten wird, nach dem sehnen wir uns. Diesen Erwählten himmeln wir an. Und mag er noch so schlecht gewonnen haben vergangenen Sonnabend.
1999
| Mo, 14.06.2010 | link | (3283) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ertuechtigungen |
|
|
Jean Stubenzweig motzt hier seit 6390 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00
... Aktuelle Seite
... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)
... Themen
... Impressum
... täglich
... Das Wetter
... Blogger.de
... Spenden
Zum Kommentieren bitte anmelden.
Suche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
AnderenortsSuche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
Andere Worte
Anderswo
Beobachtung
Cinèmatographisches + und TV
Fundsachen und Liebhaberstücke
Kunst kommt von Kunst
La Musica
Regales Leben
Das Ende
© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig
