Am Anfang war das Bild.
Dann kamen welche, die genauer hinzuschauen in der Lage waren und deshalb etwas dazu schrieben, wenn auch einseitig oder eindimensional, wie dieser Marcuse (es gibt noch einen anderen) das nannte. Auf jeden Fall blieb für die Nurkucker die biblia pauperum, die heute Armenflachbild(schirm) heißt. Ein gewisser Luther, den sie vorgestern einmal mehr einer Renaissance zu unterziehen versuchten, vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil das Protestantische dem Wirtschaftswachstum eher in die Schuhe des Fortschritts hilft als die südländisch-katholische oder gar jüdische Völlerei, hatte etwas gegen letztgenannte. Einen gewissen Gutenberg hatte er unterm Arm, mittels dessen Erfindung er seine Thesen nicht mehr nur an die Kirchentür, sondern den Leutchen vor den Kopf nageln konnte. Da die das meiste nicht verstanden, weil Chinesisch im Mutterleib noch nicht erfunden war, hat er gleich die erste vereinfachende Schreib(re)form mit vorgelegt, hat sogenannte Sprachbilder gemalt. Das sind aus der Umgangssprache übernommene, auf einen Einfachstnenner gebrachte Wörter oder ganze Sätze, gleichwohl solche ohne grammatikalischen beziehungsweise syntaktischen Ballast, heutzutage bekannt unter dem neudeutschen Begriff Cartoon oder auch, in der anspruchsvolleren Form, das Buch zum Film.
Entscheidend weiterentwickelt — ich will hier nicht das Paradies zerstören, indem ich bei Adam und Eva anfange und bei Tele(mord)visionen wie denen von Kain und Abel ende — hat sich das alles vermutlich über eine künstliche Sprache namens Esperanto, die allerdings unter dem Namen Internet außerordentlich mißverständlich weitergeführt wurde. Das Esperanto wollte nämlich eigene, ursächliche, eigenartige oder -tümliche Sprachen nicht ersetzen, die sollten bestehen bleiben. In der aktuellen oder auch akuten Variante oder Auslegung gibt es nur noch einen Kladderadatsch (neudeutsch mixed media, wie der Mix im Wetterbericht), in dem sich kaum noch jemand zurechtfindet, wohl nicht zuletzt deshalb, weil das als Modezwang hinzugekommene Multitasking kaum noch Konzentration zuläßt. Der hinkende Bote als quasi behinderter, also logischer- oder naheliegenderweise nachdenklicherer Mensch ist darüber gestolpert, hat es The TV-Immigrant betitelt und die Frage gestellt: «... ob es am Medium oder an dem Herumhektiken (Ist ja alles so schön bunt hier!) mancher Leute liegt, dass sie längere Texte nicht lesen oder nicht verstehen wollen.»
«Wer Medien nicht in der Weise nützt, die ihnen adäquat sind, die Stärken und Schwächen nicht reflektiert [...]», schreibt G., der wird, in meinen Worten, auch Adam und Eva nicht verstehen. Dabei wäre so manches geradezu begreifbar, also nach einem haptischen Prinzip auch das unterhaltende von Gianni Celati verstehbar; dieser Schiller, ein Deutscher eignet sich ohnehin eher zur Tiefgründelei, hat mal gemeint, die Wahrheit sei nur mit List zu verbreiten. Mich hat beispielsweise das Fernsehen vorgestern, während im Land der Kirchenaustreter die Protestsender schier endlos das hineinpredigten, was von der seinerzeitigen geistigen, vielleicht besser geistlichen Revolution übriggeblieben ist, zur Urform der geschriebenen Sprache zurückgeführt, mit der alles den Anfang über den Haufen warf: dem gedruckten Buch. Mein Blütensternengärtchen beschäftigte mich nicht nur mit einem Thema, das mich schon seit langer Zeit beschäftigt und auf dessen Zusammenhänge ich auch hier immer wieder mal hingewiesen habe, nämlich daß zumindest der europäische Konsumrausch nicht etwa aus dem wilden Westen kommt, sein geistiges Zentrum in der Ethik des protestantischen Schaffenswillens hat. Das ist nämlich ein ebenso weitverbreiteter Irrtum wie der, daß die feine Küche aus Frankreich kommt (nun gut, auch hierbei soll es sich, die Historiker sind unerbittlich gegenüber meinen lange gepflegten [Vor-]Urteilen, um ein Anekdötchen handeln, das die Gerüchteküche lange am Köcheln hielt). Ein am Smith College in Massachussetts lehrender Soziologe mit dem phantastischen Namem Rick Fantasia bestätigte zur Jahrtausendwende meine langjährige Beobachtung des französischen Supermarché, die ich hier vor gut drei Jahren unter USA in unseren Köpfen zusammengefaßt habe.
 Die Entstehung des Kaufhauses stand auf dem Programm, erzählt wurde vom Bon Marché, im Jahr 1838 eröffnet und 1848 von Aristide Boucicaut übernommen und ausgebaut, der erste Konsumtempel, der seine Pforten einer neuen Pariser Bourgeoisie öffnete, dessen Idee von den US-Amerikanern übernommen und später als deren Erfindung gedacht wurde. Es war ungemein unterhaltsam aufbereitetes Wissen, das die auf der linken Seite des Rheins aufbereitet haben. Nur zu gerne empfehle ich diese Dokumentation, die wiederholt wird.
Die Entstehung des Kaufhauses stand auf dem Programm, erzählt wurde vom Bon Marché, im Jahr 1838 eröffnet und 1848 von Aristide Boucicaut übernommen und ausgebaut, der erste Konsumtempel, der seine Pforten einer neuen Pariser Bourgeoisie öffnete, dessen Idee von den US-Amerikanern übernommen und später als deren Erfindung gedacht wurde. Es war ungemein unterhaltsam aufbereitetes Wissen, das die auf der linken Seite des Rheins aufbereitet haben. Nur zu gerne empfehle ich diese Dokumentation, die wiederholt wird.Mich hat's im Anschluß daran direkt zum Bücherregal getrieben. Darin stand nämlich Au Bonheur des Dames von Émile Zola, das ich vor Jahrzehnten bereits einmal gelesen habe, es allerdings für vernachlässigbar hielt, da ich Liebesgeschichten außer meinen eigenen oder den hochdramatischen anderer nicht sonderlich zugeneigt bin und vermutlich, weil meine Studien zum französischen Konsumrauschhaus seinerzeit noch längst nicht ingang gekommen waren. Doch nachdem innerhalb der Sendung daraus einige Male zitiert wurde, lese ich es aus einer völlig neuen Perspektive. «Wer Medien nicht in der Weise nützt, die ihnen adäquat sind, die Stärken und Schwächen nicht reflektiert ...»
Das Ganze stellt die erneut die Frage nach Liebe und Ästhetik. Folge ich Zola, dessen Zeit aus der heutigen beleuchtend, ist auch die eine reine Männerkonstruktion, die die (von ihnen geschaffene?) offensichtliche Schwäche der Frauen obendrein schamlos ausnutzt. Aber darüber muß ich erstmal mittagsschlafen.
Die obige Abbildung zeigt den Boulevard Haussmann nach seiner Vollendung. Von dieser Lithographie aus meinem Kunstkeller (andere nennen das Depot oder Fundus, in dem alles in der Finsternis der Vergessenheit verschwindet, bis die Braggelmann kommt) habe ich eine etwas größere Ansicht beim Stubenzweig der bunten Bildchen eingestellt.
| Di, 01.11.2011 | link | (3185) | 1 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ich schau TeVau |

| Sa, 29.10.2011 | link | (2777) | 3 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |
Auf der Suche nach der verlorenen Identität
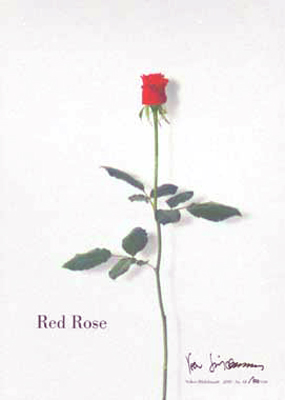 Über das Alter sprachen wir, der an Jahren auch nicht mehr so ganz Frische und ich, der in meiner Jugend von Zukunftsweisen darüber belehrt worden war, daß ich in meinem heutigen Alter ziemlich über das Verfallsdatum hinaus gewesen wäre. Allenfalls noch tägliches Rasenmähen, Laubrechen und überhaupt den Garten sauberhalten durch den vitalen Einsatz von chemischen Vernichtungsmitteln von Unkraut würde mein Leben als Rentner noch erträglich machen, in dem es ansonsten kaum noch etwas zu tun gäbe. Wobei des anderen Gedanken sich ausgesprochen mit meiner Parallelwelt verquickten und wir gemeinsam auf den Punkt kamen, ach, das vielzitierte Unkraut und so, das vergehe ohnehin nicht, und ob's das überhaupt gebe, auch eine rote Rose sei nunmal eine Art eßbares Kraut, ob sie nun aus Afrikas Gewächshäusern zu den Billigheimern angeflogen käme oder auf einem Grabstein für die Ewigkeit dahinwelke oder gar in einen solchen hineingemeißelt sei, letztlich gehe es bei den Rösleins doch nur immer um ein und dasselbe, zähle am Ende nur die Liebe wie bei Frau Stein. Und schließlich sei das heutzutage ohnehin kein Alter mehr, fügte er mit dem Nachdruck einer gehobenen Augenbraue an. Wahrlich, dachte ich so in mir drinnen für mich hin, Unkosten gebe es ja auch nicht, allenfalls Belastungen, die man sich selber auferlege, überdies fingen viele mit siebzig an, sich mittels Motorsegler in den Himmel zu erheben, gleichwohl mit Fallschirm versehen, oder sich in die Hölle zu stürzen, vorsorglich durch ein Gummiseil gesichert. Kurz ins Grübeln kam ich noch, da ich mich zu erinnern gezwungen war, daß mein Vater seinerzeit kurz vor Vollendung seines siebten Jahrzehnts war, als mein erster Schrei ihn ein wenig, in Maßen auch die damals vierzigjährige Gefährtin und zu dieser Zeit alles andere als junge Mutter, aber keinesfalls die Welt beglückte.
Über das Alter sprachen wir, der an Jahren auch nicht mehr so ganz Frische und ich, der in meiner Jugend von Zukunftsweisen darüber belehrt worden war, daß ich in meinem heutigen Alter ziemlich über das Verfallsdatum hinaus gewesen wäre. Allenfalls noch tägliches Rasenmähen, Laubrechen und überhaupt den Garten sauberhalten durch den vitalen Einsatz von chemischen Vernichtungsmitteln von Unkraut würde mein Leben als Rentner noch erträglich machen, in dem es ansonsten kaum noch etwas zu tun gäbe. Wobei des anderen Gedanken sich ausgesprochen mit meiner Parallelwelt verquickten und wir gemeinsam auf den Punkt kamen, ach, das vielzitierte Unkraut und so, das vergehe ohnehin nicht, und ob's das überhaupt gebe, auch eine rote Rose sei nunmal eine Art eßbares Kraut, ob sie nun aus Afrikas Gewächshäusern zu den Billigheimern angeflogen käme oder auf einem Grabstein für die Ewigkeit dahinwelke oder gar in einen solchen hineingemeißelt sei, letztlich gehe es bei den Rösleins doch nur immer um ein und dasselbe, zähle am Ende nur die Liebe wie bei Frau Stein. Und schließlich sei das heutzutage ohnehin kein Alter mehr, fügte er mit dem Nachdruck einer gehobenen Augenbraue an. Wahrlich, dachte ich so in mir drinnen für mich hin, Unkosten gebe es ja auch nicht, allenfalls Belastungen, die man sich selber auferlege, überdies fingen viele mit siebzig an, sich mittels Motorsegler in den Himmel zu erheben, gleichwohl mit Fallschirm versehen, oder sich in die Hölle zu stürzen, vorsorglich durch ein Gummiseil gesichert. Kurz ins Grübeln kam ich noch, da ich mich zu erinnern gezwungen war, daß mein Vater seinerzeit kurz vor Vollendung seines siebten Jahrzehnts war, als mein erster Schrei ihn ein wenig, in Maßen auch die damals vierzigjährige Gefährtin und zu dieser Zeit alles andere als junge Mutter, aber keinesfalls die Welt beglückte. Wie alt oder jung also man sich fühle. Das letzte Gespräch lag einige Jahre zurück, aber es war, als ob einer von uns lediglich kurz abgelenkt worden wäre und den Austausch direkt fortsetzte, wie das so ist bei Veranstaltungen, die wir beide nicht sonderlich schätzen, die zu besuchen wir aber beruflich genötigt waren, bei denen selbst in der verstecktesten Ecke jemand vorbeikam, den man kannte und zu begrüßen hatte, manchmal auch wollte, weil es schließlich auch auf den zu seelenlosen, zum Event verkommenen Kunstmärkten Menschen gibt, die interessant oder sympathisch oder etwas ähnliches sind und mit denen es durchaus, also nicht nur nach Rockkonzerten, glücklich beisammensitzen war. Es lag in der Natur unserer Begegnung, daß wir über Kunst sprachen. Doch die war, wie bei unserem letzten Gespräch, beinahe marginalen Charakters, wenn sich das so bezeichnen läßt bei Menschen, in deren Tages- wie Nachtgeschäft Arbeit und Leben eins sind, die sich des Privilegs bewußt sind, nicht trennen zu müssen zwischen dem mittlerweile zum Job mißratenen Broterwerb und der Freizeit, die sich nie auf die schönste Zeit des Jahres freuen müssen, weil es die nicht gibt in der eigentlichen Romantik, in der nämlich nicht das ach so romantische Wochenenddinner bei Candlelight im Wellnesshotel oder am Ende gar gleich drei davon hintereinander zählen, sondern Kunst und Leben identisch sind. Wir waren uns (mal wieder) einig, und herhalten mußte einmal mehr der Falentin Karl: Fremd ist der Fremde nur in seiner Bestimmung. Zwangsläufig kam der Gesprächspartner also auf einen Künstler zu sprechen. Über dessen Frische habe er als junger Mensch sich immer so gewundert, daß er ihn, siebzig sei er damals gewesen, der andere, gefragt habe, wie er das bloß so mache, daß er auf ihn immer so jugendlich wirke. Die zentrale Antwort habe gelautet:
Nun ja, Identität hin oder her — nun kommt wieder so ein verfluchtes, verherbstetes Wochenende, während dem man nicht einmal einfach Laubsaugen oder -blasen oder Holzkreischsägen oder rasend Mähen darf. Nur noch Lyrisches hören und lesen. Was ist das denn für ein Leben?!
Eine Menge romantische Links und überhaupt Hoffnungsloses.
| Fr, 28.10.2011 | link | (2485) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
|
|
Jean Stubenzweig motzt hier seit 6419 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00
... Aktuelle Seite
... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)
... Themen
... Impressum
... täglich
... Das Wetter
... Blogger.de
... Spenden
Zum Kommentieren bitte anmelden.
Suche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
AnderenortsSuche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
Andere Worte
Anderswo
Beobachtung
Cinèmatographisches + und TV
Fundsachen und Liebhaberstücke
Kunst kommt von Kunst
La Musica
Regales Leben
Das Ende
© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig
