Der schöne Strich
«Jebn Se mal her die Kladde, ick schreibe quer», sagte der melancholische Pseudonomiker und zückte sein Schreibgerät. Wer das bei ihm liest, weiß selbstverständlich, daß es sich dabei nur um eine edle Feder gehandelt haben kann, vermutlich eine von Montblanc.

Der Unterschied zwischen einer schlichten Mitteilung und einem von Hand geschriebenen Liebesbrief verhält sich heutzutage wie ein Beförderungsmittel aus digital-elektronisch gesteuertem öffentlichen Personennahverkehr zu einem beschaulicheren Gefährt. Der durch Reklameappli-kationen in der Regel besonders verhäßlichte Kugelschreiber hat die Menschheit nivelliert, und zwar ziemlich nach unten. Wo weder Auf- noch Abstrich sichtbar werden, verliert die Handschrift ihren Charakter, wird aus einem ursprünglich angestrebten Mahl zum Fest ein bei der Nahrungsmittelgroßindustrie erworbenes und immergleichen Hitzewellen ausgesetztes Gemisch aus Widrigkeiten.
Der Börsenjobber, der Generaldirektor, der Illuminator der güldenen zwanziger Jahre, zu denen gleich heute die einen tanzten und die Mehrheit hart ackerte, die fixierenden oder memorierenden Zeitgenossen wie etwa Roth oder Tucholsky, die wären mit einem dieser 1927 aus den Hirnwindungen eines Chemikers namens Bruno von Zychlinsky in die Fabrikation übergegangenen kugelig schmierenden Schreibers undenkbar gewesen. Der Mann von Welt ließ (s)eine Edelfeder Striche ziehen. Und die Dame tat es nicht anders. Solch ein feines Gerät wurde gar vererbt. Über meine Frau Maman erreichten mich auf diese Weise ein von ihr in den späten Zwanzigern in London erstandener Parker sowie ein Burnham.
Heute wüßte ich gar nicht einmal mehr, in welchem der vielen Kartons auf den Dachböden ich suchen sollte, wo sie samt den anderen, die ich mir im Lauf der Zeit auf der Suche nach der verlorenen zugelegt hatte und mit denen ich meine dreißig und mehr Seiten langen leidenschaftlichen Briefe der Liebe geschrieben habe, vor sich hin antiquieren. Doch ich könnte ohnehin nicht mehr mit ihnen kalligraphieren. Irgendwann hatte ich nämlich begonnen, noch jeden Notizzettel maschinell zu beschriften. Und als mich nach dem Eintritt ins Computerzeitalter mit einem Mal wieder die Lust wenigstens am schönen Schreiben überkam, war die Handschrift dahin. Es war offensichtlich: Das Laufen, das Schwimmen oder das Radfahren verlernt man nicht, der schöne Tintenstrich hingegegen wird zum auslaufenden Modell. Mit viel Mühe wurde im Lauf weiterer Zeit und quasi im Zug einer Reha-Maßnahme aus einer einstmals flotten und stolz aufgerichteten hohen Schrift *, die ich vermutlich ebenfalls von Frau Mutter geerbt hatte, ein nach rechts geneigtes, geradezu bieder wirkendes Gekrakle mit kaum noch sichtbaren Höhen und Tiefen, bei dem die Erbmasse des naturwissenschaftlich orientierten Vaters zu obsiegen schien. Und das alles — das ist die eigentliche Tragik — nur noch mit (weichem!) Bleistift. Es hatte sich ausgekleckst.
«Die rechte Hand wird wie ein Tanker in den Hafen gezogen von Lotsen. Die schwere starre Hand. Die bedrückend kalkige Hand. Die Gipshand, die Frustrierhand, die Hand an der Amtskette, weiß von Frustration, die Hand die schreiben kann, die aber von Anfang an nicht zum Schreiben begabt war. Nicht zum Schreiben, nicht zum Stricken, die fleißige Hand, die Schönschreibhand, die 5. Kolonnenhand, aber natürlich auch die Sublimierhand. [...] Auf der einen Seite die Frustrier- & Kulturhand, auf der anderen das Händchen.»
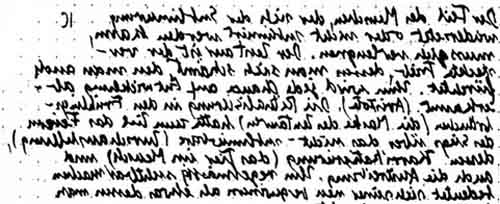
| Mi, 22.12.2010 | link | (4528) | 1 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |
Früher oder später Straßenbau

Endlich ist es soweit. Die Antwort auf die Frage nach «dem Leben, dem Universum und allem» kann man vom 28. Dezember (1982) an im Bayerischen Rundfunk erhalten. In sechs Folgen zu je fünfzig Minuten versucht der britische Hörspielautor Douglas Adams mittels seiner Science-fiction-Satire Per Anhalter ins All erschöpfend Auskunft zu geben über die brennenden Probleme der Menschheit: Warum wir leben, warum wir sterben und warum wir zwischendurch soviel Zeit mit Digitaluhren am Handgelenk verbringen. Der Bayernfunk hat mit diesem Sechsteiler sein teuerstes Hörspiel produziert, SWF (ab 12. Januar wöchentlich) und WDR (ab 13. März) halfen als Coproduzenten bei dem 150.000-Mark-Projekt.
Das Spektakel beginnt mit der Apokalypse und bringt gleich britischen Humor ins Spiel. Arthur Dent, ein Erdling wie wir, sieht sich eines Morgens Preßlufthämmern und Bulldozern gegenüber: Sein Haus soll abgerissen werden, um Platz für eine Umgehungsstraße zu schaffen. Seinen Sitzstreik beendet Arthur allerdings nach wenigen Minuten, da sein Freund Ford Prefect auftaucht und ihm klarmacht, es gäbe Wichtigeres: Die Welt geht unter, weil draußen im grenzenlosen All eine Bauflotte der Vogons, eine Art galaktischer Techno-Faschisten, den Auftrag hat, die Erde zu beseitigen, um eine intergalaktische Umgehungsschneise zu bauen. Und es passiert: Unser Planet wird zerstört. Doch damit geht's erst richtig los: Arthur und Ford können nämlich gerade noch per Anhalter mit einem Raumschiff ins All entwischen. The Hitchhiker's Guide To The Galaxy bescherte der BBC im Jahr 1978 die höchsten Einschaltquoten. Hierzulande wurde man erst wach, nachdem Hans Pfitzinger den Stoff der Hörspielabteilung des Münchner Senders vorschlug. Er rannte offene Türen ein. Science-fiction, und auch noch komisch — das war endlich mal was. Ernst Wendt, Regisseur und Chefdramaturg der Münchner Kammerspiele, übernahm die Regie, und eine Reihe prominenter Mimen trat die galaktische Sprachreise an: Dieter Borsche, Markus und Rolf Boysen, Hans Korte, Klaus Löwitsch, Felix von Manteuffel, Hans Reinhard Müller und Helmut Stange. Die Frauen im All sprechen Barbara Freier und Doris Schade, Bernhard Minetti reiste für den einzigen Satz des durch den Raum schwebenden Wals an, die Musik komponierte Frank Duval, und die Toneffekte, mit denen das ganze Audio-Unternehmen steht und fällt, stammen von dem Toningenieur Günther Hess ... Die beiden Helden abenteuern vorwärts und rückwärts durch Raum und Zeit, bedienen sich des galaktischen Kreuzers Herz aus Gold und der neuesten Entwicklung auf dem Gebiet der Fortbewegung, dem Unwahrscheinlichkeits-Antrieb.
Sie erfahren, daß der Mensch nicht, wie bisher angenommen, das zweitintelligenteste Lebewesen der Erde (nach den Delphinen) war: Die Mäuse, jene Nager, die zur Tarnung in den wissenschaftliehen Labors in Laufrädchen herumrannten, hatten ursprünglich unseren Planeten maßschneidern lassen. Sinn des Unternehmens: Die Erde sollte als Computer enormen Ausmaßes die Antwort auf die Frage aller Fragen finden. Dummerweise schlugen aber die Vogons fünf Minuten zu früh zu. Den Mäusen bleibt nichts anderes übrig, als noch einmal von vorn zu beginnen. Slartibartfast, Spezialist für Küstenlinien, der einst für Norwegen einen Preis gewann, macht sich wieder an die Arbeit.
Bis sie die Antwort erfahren (sie lautet forty-two), müssen Arthur und Ford noch mit allerlei lebensgefährlichen Begegnungen fertig werden, lernen den Erfinder des stärksten Drinks aller Zeiten (der Pangalaktische Gurgelsprenger) kennen und landen schließlich auf einer prähistorischen Erde, die von Sekretärinnen und Versicherungsvertretern bevölkert ist.
Wenn das Spektakel einschlägt, plant der BR fünf weitere Folgen im neuen Jahr. Titel der Fortsetzung: Das Restaurant am Ende des Universums.
Ich erinnere mich wie heute, ein Virus hatte mich hingestreckt, aber keiner vom Schwein oder vom Vogel, die hatten seinerzeit noch andere Aufgaben, als Gazetten zu füllen, und so nahm ich im rinnenden Schweiß meines Fiebers und unter nachweihnachtlichem Schüttelfrost die erste Folge und folglich die folgenden auf, aber die Bänder gingen verloren, als ich meine Plünnen auf verschiedene Orte verteilte. Zu dieser Zeit konnte man so etwas nicht einfach ordern, da brauchte es mehr als gute Beziehungen; wollte man an solche Bänder herankommen, mußte man mit der Redaktionsdame im vierten Jahrzehnt mindestens einmal den berühmten oder auch berüchtigten BR-Fasching durchgetanzt haben.
Weshalb darf ich so etwas nicht nachkaufen? Als Hörspiel. Nicht als Blinkegefunkel. Die Sendeanstalten bieten doch mittlerweile auch die Lindenstraße oder sogar völlig weißwaschgezeichnete Seifenopern an. Aber das sind eben alles Flimmerbilder. Einmal mehr dürfte das ein Minderheitenproblem sein.
Flohmarkt: Savoir-vivre, 1982
| Mo, 20.12.2010 | link | (6861) | 11 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |
Chume, chum geselle min
Der Geselle läßt sich nicht lange bitten und verschwindet, nachgerade dem Alten Testament Folge leistend, mit der drallen Weißnäherin hinterm Busch. Die genüßliche Aufforderung mittelalterlicher Liedermacher entstammt den Carmina Burana, einer Sammlung wilder, geiler und zärtlicher Sauf-, Freß- und Liebeshymnen, die um 1800 in dem oberbayerischen Kloster Benediktbeuren gefunden und von Carl Orff neu vertont wurden.* Und der wollte die Beurener Lieder, als sein 81ster Geburtstag mit dem 650sten seines Heimatortes Dießen am Ammersee zusammenfiel, im dortigen Kloster aufführen. Doch die zunächst erteilte Genehmigung des Augsburger Generalvikariats wurde auf einen Protest der Pfarrgemeinde hin flugs wieder zurückgezogen. Die Frankfurter Rundschau kommentierte lakonisch: «Was in einem Kloster gefunden wurde, darf noch lange nicht daselbst aufgeführt werden.» Was Liedermacher dichten, muß also nicht unbedingt politisch sein, um Anstoß zu erregen. Die Carmina Burana gelten als Vorläufer der Studentenlieder. Und nachdem der Numerus Clausus die Studenten von der Straße wieder hinein in die Verrbindungslokale zurückgefegt hat, ist das Gaudeamus igitur wieder hochaktuell. Doch nicht nur die Akademiker in spe tanzen und saufen nach der alten Melodei. Mittelalterliche Laute sind heute allgemein wieder gerfagt. Gruppen wie Elster Silberflug oder Ougenweide scheinen den Interpreten der Politlyrik im Sinn von Väterchen Franz die Schau gestohlen zu haben.

Den Vater von Väterchen Franz namens Josef Degenhardt ficht die überschwappende Nouvelle Vague des Alten Lieds allerdings nicht an. Er, der 1963 die Pforte zum ersten deutschen Liedermacher-Festival auf Burg Waldeck aufstieß, verkauft nach Auskunft seines Vertreibers mehr Platten denn je. Knut Kiesewetter, der mit Gesängen wie Komm aus den Federn, Liebste vor zehn Jahren zehn Jahre zu früh auf den Markt kam und heute politisch konkreter textet, veräußert damit immerhin pro Scheibe dreißig- bis vierzigtausend Exemplare. Es gibt zwar das Fest auf Burg Waldeck seit 1975 nicht mehr, dafür aber liederliche Festivitäten in Mainz, Ingelheim, Nürnberg, Essen und viele andere mehr.
Dennoch ist die Szenerie der garstigen politischen Liedermacher der sechziger Jahre ganz offensichtlich Geschichte. Anders läßt es sich nicht erklären, daß Hannes Wader sich dem Zeitgeist entsprechend mit Ostfriesischem unverständlich macht, die Alt-Barden sich eine Rüstung in Form der gewerkschaftlichen AG Song angelegt haben, die unakademisch mit der Dokumentation Wie wird es weitergehen? resümiert, dafür der Mainzer Josef Maria Franzen mit seiner Dissertation über Liedschreiber die Vergangenheit auf eventuelle Mißtöne hin abklopft.
Es ist die tiefinnerliche Vergangenheit selbst, die wieder en vogue ist. Das Wer bin ich eigentlich? von André Heller und die netten Lieder eines Reinhard (links des Rheins eher als Frédéric bekannt) Mey, wie das niedliche vom Wecker im Kühlschrank, verbreiten sich epidemisch in Rundfunkanstalten und Kleinkunstbühnen. Die Plattenindustrie schließt sich der allgemeinen Experimentierunlust an und investiert lieber in eine «Heckparade» der Pseudolyriker. Die Inflation hat auch vor den Liedermachern nicht Halt gemacht — die Unternehmen kennen schon nicht einmal mehr die Umsätze aller ihrer neuen Sangesmenschen.
Auch der Witz in den Texten scheint eliminiert. Kaum noch Ulrich Roski, kaum noch Blödeleien wie die von Schobert und Black. Die Platte Liederspenstig des Münchners Jörn Pfennig mit wirklich pfiffigen Texten wurde nach zwei Jahren eingestampft — der Biß eines François Villon, dem großen Vorbild vieler Lieddichter, ist dahin. Die vielzitierte neue Innerlichkeit hat auch den Benn-Liebhaber Konstantin Wecker ergriffen, der von «süßen Giften der Einsamkeit» erzählt, «die nachts die Straße runterrinnen».
Und wenn mal einer wie der Wiener Georg Danzer mit seinen Texten so aus dem Leben schöpft, wie es Villon und die Mönche und Studiosi des 13. Jahrhunderts aus dem Kloster Benediktbeuern vorgemacht haben, dann machen es die ratlos (?) Verantwortlichen der Rundfunkanstalten der Kirche nach: sie verbieten. Zum Beispiel einen Titel von Danzers Platte Unter die Haut. Er ging fünfzig Prozent derart unter die Haut, daß er nicht mehr gespielt werden darf: «War da etwa Haschisch in dem Schokoladenei?».
* Sie wurden in der seinerzeit sensationellen Inszenierung von Jean-Pierre Ponelle aus dem Jahr 1975 vom Bayerischen Rundfunk und, seinerzeit ein absolutes Novum, zeitgleich im zweiten Programm des Hörfunks — in Stereo! — ausgestrahlt.
Flohmarkt: Savoir-vivre, 1978
| Fr, 17.12.2010 | link | (3766) | 9 K | Ihr Kommentar | abgelegt: La Musica |
|
|
Jean Stubenzweig motzt hier seit 6429 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00
... Aktuelle Seite
... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)
... Themen
... Impressum
... täglich
... Das Wetter
... Blogger.de
... Spenden
Zum Kommentieren bitte anmelden.
Suche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
AnderenortsSuche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
Andere Worte
Anderswo
Beobachtung
Cinèmatographisches + und TV
Fundsachen und Liebhaberstücke
Kunst kommt von Kunst
La Musica
Regales Leben
Das Ende
© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig
