Grau ist jede Suche. Bis sie rote Sprenkel kriegt.
Um eine Fußnote lesbar zu machen, fahre man mit dem Cursor mitten hinein in die jeweilige Ziffer.1
Interkulturelle Hermenautik wird heutzutage genannt, was vor noch gar nicht so langer Zeit einmal Imagologie hieß. Von diesem Terminus hat sich wie so vieles nach Bedeutsamem Klingendes in den heutigen deutschen Sprachgebrauch des Alltags das Rudiment Image eingeschlichen wie die rezeptfreie Droge Multivitamin, mit dem Lukas, Markus oder Tobias, (früher, noch ohne EiPäd, gemeinhin Fritzchen) von Irgendwas mit Medien seiner Mascha, Sascha oder Penelope (früher, noch ohne EiPhone, gemeinhin Lieschen) von hinterm Tresen seines Stammcafés mit Pappbechern von seinem aufregenden Leben als Anonymus auf den virtuellen Schlachtfeldern der grünen Planeten zeigt, seine mittelständische Vorstellungswelt von Wir nennen es Arbeit vorführt, geradezu ungeheuerlich selbstbewußt und auch -ironisch, gleichwohl nicht auf seine Befindlichkeitshieroglyphen verzichten wollend, will doch ein Image entsprechend gerahmt werden, will man es tatsächlich als Kunstwerk erkennen.2
Wie ich darauf komme? Weil ich mir nach wie vor nicht vorstellen kann, daß ich ein Buch nicht finde. Das mag an dem Bild liegen, das ich mir von ihm so vor mich hin imaginiere. Über eine sehr lange Zeit habe ich mal nach einem Buch gesucht, aus dem ich eine Fußnote nachtragen wollte, deren sofortiger Eintrag mich scheinbar zuviel Zeit im Schreibfluß gekostet hätte. Ungeschickterweise hatte ich mir, wie sonst üblich, keinen Zettel für den großen Kasten geschrieben, in dem ich mit Sicherheit irgendwann fündig geworden wäre. Die Zeit floß und floß, ich war letzten Endes kurz davor, an diesen Heraklit zugeschriebenen philosophischen Anzeigentext bei diesen seriösen Agenturen für aus paritätischen Gründen nach noch besser verdienenden Partnern Suchenden zu denken. Es mußte damit zusammenhängen, daß meine sich wirr windenden oberen Pigmentröhren die Farbe des Buchrückens in das Grün der Hoffnung umgewandelt hatten, nach dem ich fortwährend gesucht und den ich nicht gefunden hatte, so daß ich dann als Fußnote eine imaginäre, dem Inhalt sich annähernde Quelle angab, die mir leichten bis ausreichenden Ärger hätte einbringen können, wäre dieser Aufsatz prüfenden Auges genauer gelesen worden.3 Dieses unzettelig gesicherte Wissen kann einen ja enorm durcheinanderbringen. Zwei Jahre, es mögen auch drei gewesen sein, gingen in den Fluß der Zeit, sozusagen ins Panta rhei, bis ich auf das Werk stieß, das sich schließlich als grau erwiesen hatte während der immerwährenden Suche nach einem grünen.
Grau, gleichwohl mit sinnlich roten, das Maurische assoziierende Sprengseln versehen, ist auch das, auf das ich heute stieß in meiner Abteilung französischer Literatur, die mich dazu bringen soll, mein freizeitliches Geklöpple des Alphabets fortzuführen. Es handelt sich um eines der neueren und neuesten spanischen; was so auch nicht mehr zutrifft, da es 1998 erschienen ist. Andererseits ist es sozusagen naheliegend, geht es dabei doch um die Imagologie, wie früher die Interkulturelle Hermenautik genannt wurde, die Forschung und Lehre dessen, das mich gute zehn Jahre lang mit wissenschaftlichen Assistenten in Kellern verschiedener Universitäten hat Pingpong spielen lassen und die, wie es in dem Buch heißt, nach dem ich nicht gesucht habe, in dem ich mich aber mittlerweile festgelesen habe, weil ich gerne in älteren Büchern (wieder-)lese und weil ich die Thematik nach wie vor für eine der spannendsten überhaupt halte, «die Erforschung des Bildes vom anderen Land». Manchmal sagt man dazu auch Komparatistik oder vergleichende Literaturwissenschaft, von der die hier hin- statt einführende Autorin in ihrem sinnig sinnlich gesprenkelten grauen Buch schreibt:
 «Die größere Aufmerksamkeit, die [Soziologie, hier Karin] Knorr-Cetina12 nämlich den Phänomenen Situationalismus und Interaktion zuteil werden lassen möchte, hat in der Literaturwissenschaft eine Entsprechung. Das Erkenntnisinteresse der Literaturwissenschaft richtet sich darauf, auf welche Weise eine vorgefundene außerliterarische Realität eben nicht im literarischen Text abgebildet, sondern transformiert wird. Ein Text bildet ein Gewebe aus Gelesenem, Vorgefundenem, Erfundenem. Dieses Gewebe wiederum interagiert mit der spezifischen Lebenssituation, Textkenntnis u. ä. des jeweiligen Lesers. Wenn diesem Interaktionsfeld zwischen Autor, Figuren, Leser, Vortext und Texten von imagologischen Untersuchungen die ihm gebührende Bedeutung zuerkannt würde, wäre die Handhabung von ‹Eigenem› und ‹Fremdem› als zwei eindeutig trennbaren Kategorien hochgradig problematisch. Vermutlich ist dies einer der Gründe, weshalb die Imagologie, die solche Kategorien weiterhin handhabt, das Verunsicherungspotential nicht zur Kenntnis nehmen möchte. Wenn wir uns nun erneut die eingangs erwähnte Zielvorgabe der Disziplin — die Erforschung des Bildes vom anderen Land — vergegenwärtigen, ahnen wir bereits, wie gründlich eine methodische Neuorientierung der Imagologie ausfallen müßte.»13
«Die größere Aufmerksamkeit, die [Soziologie, hier Karin] Knorr-Cetina12 nämlich den Phänomenen Situationalismus und Interaktion zuteil werden lassen möchte, hat in der Literaturwissenschaft eine Entsprechung. Das Erkenntnisinteresse der Literaturwissenschaft richtet sich darauf, auf welche Weise eine vorgefundene außerliterarische Realität eben nicht im literarischen Text abgebildet, sondern transformiert wird. Ein Text bildet ein Gewebe aus Gelesenem, Vorgefundenem, Erfundenem. Dieses Gewebe wiederum interagiert mit der spezifischen Lebenssituation, Textkenntnis u. ä. des jeweiligen Lesers. Wenn diesem Interaktionsfeld zwischen Autor, Figuren, Leser, Vortext und Texten von imagologischen Untersuchungen die ihm gebührende Bedeutung zuerkannt würde, wäre die Handhabung von ‹Eigenem› und ‹Fremdem› als zwei eindeutig trennbaren Kategorien hochgradig problematisch. Vermutlich ist dies einer der Gründe, weshalb die Imagologie, die solche Kategorien weiterhin handhabt, das Verunsicherungspotential nicht zur Kenntnis nehmen möchte. Wenn wir uns nun erneut die eingangs erwähnte Zielvorgabe der Disziplin — die Erforschung des Bildes vom anderen Land — vergegenwärtigen, ahnen wir bereits, wie gründlich eine methodische Neuorientierung der Imagologie ausfallen müßte.»13Außerdem erinnere ich mich gerne an die Verfasserin dieser Imagologie, nicht nur, weil ich deren Imago auch nach recht langer Zeit noch ziemlich genau im Kopf habe, die vor Beendigung des vergangenen Jahrtausends durchaus in meine Vorstellungswelt paßte von einer nicht nur wohlansehnlichen, sondern darüber hinaus klugen und intelligenten und gebildeten, also intellektuellen jungen Frau, mit der man nicht nur wesentliche Gespräche führen, sondern auch ordentlich einen trinken konnte.
In ihr ertrinke ich also gerade statt zur rettenden Insel meines Freizeitwerks zu schwimmen. Sie taucht mich tief ein in meine spätere, bis heute andauernde Jugend, indem sie mich an diese Frische erinnert, mit der ich mich eine Zeitlang gerne beschäftigt habe, etwa an die von Georges Perec oder Raymond Queneau, überhaupt an die Gruppe Oulipo, an L'Ouvroir de Littérature Potentielle (etwa: Werkstatt für Potentielle Literatur), der ja auch mein inniggeliebter Italo Calvino angehörte, in der sie absolut belesen war (und vermutlich noch ist, obwohl sie vermutlich des schöden Mammons wegen in eine andere Abteilung der Imagos umzuziehen gezwungen war). Sie hat übrigens auch Zettels Wirtschaft betrieben. Als ich das Buch von meiner Galerie hinuntertrug, in der die besonderen Franzosen und Italiener und Spanier, diese Romanen also, von denen auch die die Romantiker abstammen (La vie est un roman), sowie Erstausgaben und auch während fröhlicher Feiern nicht nur um Bücher völlig kunstverkritzelte Kataloge oder, eben, gewidmete Dissertationen von schlimmen Erbkrankheiten («In Liebe») über chemische Prozesse zur Waschmittelherstellung (Ewig Dein!») bis, genau, fragwürdiger fremdländischer Literatur («Je sui un autre.») vergiftschrankt sind, entfiel ihm ein Blatt mit einer Vorrede, die einen Schluß auf ihre geistige Haltung zuläßt, in der ich es mir nach langer Zeit jetzt behaglich machen werde.
Dieses Buch ist ein tolles Buch. Die Verfasserin jedenfalls kann nicht besser (und anders übrigens auch kaum). Es handelt von der schlimmen Welt, in der die Wissenschaftler schreiben und davon, was an diesem Schreiben so schlimm ist. Aber es handelt auch von Kriechwurzeln, Ikarusflügeln aus Messerklingen, kindischen Säulenheiligen und verbeulten Kaffeedosen, die ich alle selbst bezahlt habe. [...]Die Fortführung meines sicher außerordentlich wichtigen Werkes zur Weltrettung muß warten. Aber wahrscheinlich ist der Rücken des Buches ohnehin tiefschwarz und nicht grün wie die Hoffnung. Vielleicht begegnen wir uns mal wieder, die vermutlich immer noch junge und frische Frau und ich in den Jahren Verkommener. Dann würden wir sicher über Bücher sprechen, die ohne den Buchstaben E auskommen. Denn Georges Perec hat auch ein Buch geschrieben, in dem eine Frau durch die Zeilen geistert, die mich mit einem Mal im nachhinein an die da oben erinnert: So könnte sie heute als (noch?) Vierzigerin ein wenig gedankenverloren sinnierend durch das Haus in Paris streifen. Besondere Alltäglichkeiten.
Die Transkription des Arabischen wird wissenschaftlichen Anforderungen nicht gerecht, was technische Gründe hat, die zu erläutern hier kein Platz ist. Für den Schwund des Diakritischen zeichnet der Iberer verantwortlich.
Die beiden Ebenen der Repräsentation von a) außerliterarischer Wirklichkeit im literarischen Text und b) Wirklichkeit literarischer Texte in literaturwissenschaftlichen Analüsen [hic] können nach der Lektüre dieser Arbeit hoffentlich nicht mehr auseinandergehalten werden. Dabei waren Autoren wie Geertz und Castaneda ziemlich hilfreich. Andere Verunklarungen habe ich mühelos allein zuwegegebracht. Schließlich rechnet man ja auch mit Lesern, die für Kinkerlitzchen wie z. B. Rückbindung der einzelnen Kapitel an die in der Einleitung angestellten Beobachtungen nicht an die Hand genommen werden wollen.
Der Begriff der Imago wird in dieser Arbeit, in Anlehnung an den Duden, durchgehend im Sinne von ‹fertig ausgebildetes, geschlechtsreifes Insekt› gebraucht.
Im Goytisolokapitel kommt ein Baum vor, der Baum der Literatur, auf dem die Verfasserin als Spottdrossel verkleidet von Ast zu Ast hüpft. Was die meisten nicht merken: dieser Baum ist hohl.
Friederike Heitsch
Imagologie des Islam in der neueren und neuesten spanischen Literatur
Edition Reichenberger, Problemata Literaria 36
Sie, die sich später — um auch in der tiefen virtuellen Maurenwelt rascher gefunden zu werden? — den zweifelsohne auch besser zu ihr passenden zweiten Vornamen Elena gab, hat auch andere schöne Stückchen geschrieben:
vor der Imagologie, ihrer Dissertation:
• Antonio Gala und der Islam. Kritik eines Bestsellers
nach der Imagologie (auszugsweise):
• Verweigerung macht sexy, in: Valio Tchenkov, 1999 - 2002
• Ornament als Verbrechen an der Volkswirtschaft. Die Geistesverwandtschaft zwischen Adolf Loos und Arnold Schönberg, ein Hörstück, 2004, Bayern 2
• Eine Piroge voller Affen. Humboldts Fahrt auf dem Orinoco, 2004, SWR 2
• Keine einzige unwahre Note. Maske und Widerstand bei Schostakowitsch, ein Hörstück, 2006, Bayern 4 (Klassik)
| Fr, 06.01.2012 | link | (3187) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |
Semispirituelle Suchmenschenanfrage
Qui partout sème en aucun lieu récolte. (Wer überall sät, wird nirgendwo ernten.)
Eine Anmerkung vorab: Um eine Fußnote lesbar zu machen, berühre man mit dem Cursor die jeweilige Ziffer.1
Nicht zuletzt, da eine Bekannte einer Bekannten der bekannten, ja berühmt-berüchtigten, der (jedenfalls von mir) gefürchteteten Alltagsforscherin Frau Braggelmann in meinem Fragmentchen Verliebtheit, Ekstase. Hypnose und Amnesie den Satz von Jean Baruzi gelesen hat und ihn am liebsten in ein esoterisches Brevier integrieren möchte (was, wie meistens in solchen Fällen, aus dem Zusammenhang gerissen ein recht schiefes Bild produzieren kann, wie eben das, was heute heute unter Esoterik
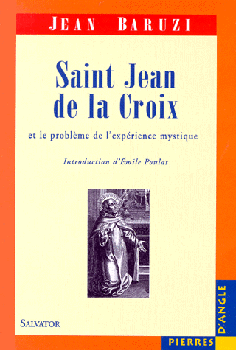 verstanden wird, also nicht mehr das Geheimwissen früherer Tage, hier etwa am Beispiel Freimaurer) — ich finde das Buch nicht, das Original: Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique, erschienen 1924, laut fnac neu erschienen 11/ 1999. Ich weiß nicht mehr, in welchem Karton auf welchem Dachboden oder tiefem Keller es sich vor eventuellem Mißbrauch versteckt — die vielen Versuche der letzten Jahre zur Heimatfindung haben mein einstmals gefestigtes System aufgelöst. Ich möchte, wie angekündigt, auch die französische Version dieses Alltagsfragmentariums einstellen: État amoureux, extase, hypnose et amnésie, doch dazu fehlt mir die originale Schreibweise des Zitats. Zwar kann ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nachfragen, aber es finden sich in letzter Zeit (erfreulicherweise) auch hier zunehmend mehr Interessenten auch an solchen philosophischen Themen ein, die ohne Religionsgeschichte auch für die heftigsten Redner gegen den Glauben schlicht nicht denkbar sind. Gerne möchte ich auch die an Fragen, nichts als Fragen beteiligen, durchaus auch diejenigen, die der Meinung sind, ich hätte den falschen, weil gar keinen Glauben (was hier und ergänzend hier begründet ist.
verstanden wird, also nicht mehr das Geheimwissen früherer Tage, hier etwa am Beispiel Freimaurer) — ich finde das Buch nicht, das Original: Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique, erschienen 1924, laut fnac neu erschienen 11/ 1999. Ich weiß nicht mehr, in welchem Karton auf welchem Dachboden oder tiefem Keller es sich vor eventuellem Mißbrauch versteckt — die vielen Versuche der letzten Jahre zur Heimatfindung haben mein einstmals gefestigtes System aufgelöst. Ich möchte, wie angekündigt, auch die französische Version dieses Alltagsfragmentariums einstellen: État amoureux, extase, hypnose et amnésie, doch dazu fehlt mir die originale Schreibweise des Zitats. Zwar kann ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nachfragen, aber es finden sich in letzter Zeit (erfreulicherweise) auch hier zunehmend mehr Interessenten auch an solchen philosophischen Themen ein, die ohne Religionsgeschichte auch für die heftigsten Redner gegen den Glauben schlicht nicht denkbar sind. Gerne möchte ich auch die an Fragen, nichts als Fragen beteiligen, durchaus auch diejenigen, die der Meinung sind, ich hätte den falschen, weil gar keinen Glauben (was hier und ergänzend hier begründet ist.Hat also jemand das Buch im Regal stehen, vielleicht sogar die Textstelle parat und möchte meine Suche beenden helfen? Es geht um den Satz:
«Es gibt keine mystische Entzückung der Seele ohne vorherige Entleerung.»2
Die Übersetzung könnte in etwa lauten:
Il n'y a aucun ravissement (enchantement) mystique de l'âme sans vidange préalable.
Ich hätte aber gerne den Originalwortlaut (der möglicherweise um einiges filigraner, durchgeistigter oder auch spiritueller [etwa im Sinne der Aussage eines wohlmeinenden Beur, der wie ein Jude niemals nicht Schweinefleisch äße, sondern immer denkt, es wär' ein Fisch, also ebenfalls nie und nimmer Alkohol tränke, der mir in l'Éstaque zwischen Marius und Jeannette sitzend nach dem fünfzehnten oder neunzehnten 51er ein ausgezeichnetes Patois attestierte] daherkommt als mein Hausmannsfranzösisch3).

| Mi, 04.01.2012 | link | (2983) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Fragen, nichts als Fragen |
Die Professorengelehrtenexpertenrepublik
Durchsetzt von einigen Insiderwitzeleien, die ich zu entschuldigen bitte, die ich mir aber nicht verkneifen kann.
Heute früh tat ich das, was ich mir eigentlich untersagt hatte, weil mir dieses volksnahe Gutgelauntsein seit je die Gutemorgenlaune verdirbt. Aber man will schließlich informiert sein, will wissen, was einem garantiert den Tag vermiesen wird. Ich schaltete also das Fernseherät ein. Da saßen zwei offensichtlich altbekannte jugendlich dynamisch wirkende Herren einander gegegnüber, und der eine sagte so etwas wie guten Morgen Magazin, Du, Herr Professor, wir haben zwar nur 1'30, aber soviel Zeit muß sein oder so ähnlich. Es ging vermutlich um Sport. Ich habe ausgeschaltet. Denn mir schwoll der Kamm der Erinnerung.
Als junger, aufstrebender Journalist war auch ich bemüht, mich bei den Koryphäen beliebt zu machen, die ich für Reportagen und Hörbilder, wie in guten alten Sprachpflegerzeiten die Features genannten Dokumentation auch genannt wurden, aber auch zu aktuellen Themata befragen durfte. So erinnere ich mich gut daran, etwa Mitte der siebziger Jahre während einer täglichen Redaktionssitzung den Abteilungsleiter des kulturellen Buntfunks darauf hingewiesen zu haben, man dürfe doch wohl dem unterministeriellen Leiter einer bundesländlichen Städte- und Verkehrsplanung seinen Professor nicht verweigern, den er auf seine Visitenkarte dezent auch ohne das Honorar- hatte drucken lassen, wozu er eigentlich gesetzlich verpflichtet gewesen wäre. Es war (noch) die Zeit, als viele an Universitäten Geistesgeschulte wie in anderen Ländern auch auf das Führen ihres Grads eines Doktors, der mittlerweile ja in einen Titel, vermutlich weil es mehr nach Adel klingt, umbenannt wurde, verzichteten, andererseits nicht nur in Nordrhein-Westfalen die Inflation der Vergabe an Honorarprofessorentiteln eingesetzt hatte, die besonders gerne an Personen verliehen wurden, die nie von einem akademischen Studium auch nur gestreift worden waren. Kurzum, meinte der unter mir leidende Redakteur, selber ein sich nicht als solcher deklarierender promovierter Mediävist, der sich darob seiner leitenden Fähigkeiten besann und daraufhin verfügte: Meinetwegen, aber dann streichen wir ihm den Doktor, denn der Herr redet mir ohnehin zu sehr wie einer, der seine akademische Würde in der Schule eines politischen Parlaments erlangt und somit nicht nicht wirklich verdient hat.1

Es scheint ja nicht mehr so viele Italiener zu geben, möglicherweise sind sie allesamt endlich alle integriert, wie die deutsche Poilitik redet, wenn sie assimiliert meint, auf jeden Fall geschieht es mir immer seltener, daß mir ein Kellner Hut und Mantel abnimmt und währenddessen dienstbeflissen zuraunt Si Professore, beninteso Professore, naturalmente Professore, es mag aber auch daran liegen, daß ich seit der Zeit keinen dieser Immigranten mehr aufsuche, seit der Opernsänger in einem Münchner Nobelristorante dem Cameriere dreimal hintereinander bedeutete, diese bis obenhin gefüllte Tasse entspreche weder einem römischen noch einem genuesischen Espresso, das sei allenfalls deutscher gefilteter kalter Kaffee, den er ebenso verweigere wie den hiesigen, der deutschen Leggerezza angepaßte Servizio, der ihm ständig etwas vom Professore in die Ohren trällere, er gastiere schießlich an der Opera und sei kein Dorfschullehrer. In dem putzigen Eiskaffee der norddeutschen Kleinstadt, in das ich manchmal wegen des hervorragenden, aus lediglich einem wohlschmeckenden Schluck bestehenden Espressos voller Lust wandle, kommt keines der nicht eben wenigen Familienmitglieder der aus dem Piemont stammenden Gelateriabetreiber mehr auf die Idee, mich so anzureden, seit ich nach der ersten derartigen Begrüßung die linke Augenbraue bedrohlich hochgezogen habe.
Aber der Lehrer der örtlichen Sonderschule, die ja auch ihre Bedrohung verloren hat, seit bekannt ist, daß auch in Pisa schlechte Noten geschrieben werden, der freut sich nach wie vor, mittels dieses Titels geadelt zu werden, der zwar nach Niederwild klingt, das so heißt, weil nur der niedere Adel die kleinen Tiere schießen durfte, was aber einen zeitgenössisch akademisierten Pädagogen nicht weiter berühren dürfte, der die Tricolore für das russische Nationalbanner hält, was in etwa den Kenntnissen von Lothar Matthäus gleichkommt, der gesagt haben soll, er habe bei seiner Blutgrätsche den Gegner doch gar nicht tangiert, was wiederum den interpreatorischen Fähigkeiten des großen österreichischen Sangesathleten Peter Alexander entspricht, dem zum besseren Verstehen samt Partnerin das Lied von den kleinen und den großen Tieren nachgedichtet wurde.2 Überhaupt lechzt die gesamte deutsche Bevölkerung, so mein Eindruck, bald mehr noch nach Erhöhung als die dieses Landes, das hinter den Alpen liegt, und dem sie sich geistig verwandt zu fühlen scheint, vermutlich weil dort der Adel abgeschafft wurde und es seit 1920 heißt:
«Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen.»3Österreich hat 1919 die französische Revolution von 1789 nachgeholt, jene Égalité übersetzt, von der viele dem Irrtum unterliegen, sie gelte auch im Alltag. Und der ist in den blühenden deutschen Landschaften so gräßlich farblos geworden, daß man sich nahezu blaublütig wirkende Titel herbeisehnt. Was liegt dabei näher als ein Professor? Das Volk braucht das offensichtlich. Dabei ist dem offenbar nicht bekannt, daß es weitaus mehr von diesen Titelträgern gibt als die wahrlich vielen bunten, manchmal auch gelb genannten Blätter wie Leute heute oder Brisant oder wie sie sonst noch alle heißen, aus denen es seine Informationen für den alltäglichen Umgang mit der Welt bezieht. Neben den oben erwähnten Honorarprofessoren gibt es nämlich noch diejenigen, die auch ohne eine dieser zeit- und denkaufwendigen Habilitationsschriften (ausgewiesen als Dr. habil., mittlerweile erkennbar am PD, dem Kürzel für Privatdozent) zum Professor werden. Ich weiß nicht, wie das heute heißt, aber früher nannten wir das Wolken- oder auch Schäfchen- oder auch verschlafene Professur, abgeleitet oder auch gemeinhin bekannt von der Dame mit den auch am oberen Rand des schwarzen Rollkragenpullis nicht endenwollenden Beinen, von diesem erotisch aufquellenden Cumulus: «Haufenwolke oder Quellwolke. Die klassische, unverwechselbare ‹Bilderbuchwolke› (auch Schäfchenwolke) mit ihrer flachen Unterseite und strahlend weißen Blumenkohlköpfen auf der Oberseite», wie Wikipedia das so schmuckelig beschreibt. bestehend «aus Wassertröpfchen und [...] in den unteren Wolkenstockwerken anzutreffen». Für manch einen ward das zum Wolkenkuckucksheim, denn nicht jeder hat die Zeit dazu, man muß schließlich auch noch Geld verdienen und seiner anderen Ämter walten.4
Das sind die Experten. Früher, zu schleyerhaften Zeiten mußten sie heimlich, verborgen hinter wallenden seidenen Shawls, ihre Titel aus gesellschaftlichen Gleichheitswängen fast schamhaft versteckt, zu gut gespült hat nie Bayreuth schweben, durften ihre stille Liebe zu Gesamtkunstwerk und Lindenstraße und Lady Di nie öffentlich machen. Heute ist das anders. Heute will das Volk endlich wieder Pracht. Und die kann nur leuchten, indem man zeigt, was man aufzubieten hat. Und wenn man schon im Fernsehen seinen SUV von BieEmDabbelYou oder sein Haus oder seine Kreditkarte nicht (das hatte ich vergessen) vorzeigen kann, dann wenigstens seine Honorarprofessur. Denn wer weiß schon, wo Tripsdrill an der Altweibermühle, die dortige Fachhochschule liegt.
1Seinerzeit gab es noch kein Internet, geschweige denn Suchmaschinen, zu der Zeit mußte man noch tief in Bibliotheken steigen und selber im Staub der Archive suchen und mußte mühsam alles eigenhändig abschreiben wie die Kopisten des uns alle so leidenschaftlich bewegenden Mediävums, als das Guttenbergisieren noch nicht erfunden war, als das Volk zudem noch keine Sprachen schrieb, und wenn es an geschriebene Information gelangte, dann bestanden diese überwiegend aus vielen hübschen oder auch schönen, allerdings nicht ganz so bunten und bewegten oder bewegenden Bildern wie die der gegenwärtigen Medienerzeugnisse, auf deren überbordende Inhalte ich in verschiedenen Zusammenhängen hier bereits mehrfach hingewiesen habe, auf die schlichteren der biblia pauperum.
2Die Großen, sagte es,/fressen ganz keck/Die Kirschen und sonstiges weg./Sie alle beanspruchten darin das nämliche Recht./Was sind das, sprach die Maus,/für dumme Faxen?/Die Kleinen müßten dann doch erst mal wachsen! (Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere ...)
3Adelsaufhebungsgesetz
4Das ist allerdings bereits eine höhere Stufe des niederen Gelehrtenadels. Denn dort muß bereits viel eines Fachgebietes veröffentlicht und auch anerkannt worden sein. Das ist die kumulative, zu der allerdings noch gesondert eine Schrift vorgelegt werden muß, die etwas mehr hergibt als ein Dankes- und Grüßaugustwort an die Honoratioren einer Universität.
| Di, 03.01.2012 | link | (6521) | 13 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |
|
|
Jean Stubenzweig motzt hier seit 6455 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00
... Aktuelle Seite
... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)
... Themen
... Impressum
... täglich
... Das Wetter
... Blogger.de
... Spenden
Zum Kommentieren bitte anmelden.
Suche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
AnderenortsSuche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
Andere Worte
Anderswo
Beobachtung
Cinèmatographisches + und TV
Fundsachen und Liebhaberstücke
Kunst kommt von Kunst
La Musica
Regales Leben
Das Ende
© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig
