Eisenbahnromantik

Besonders in deutschen Landen frisch auf den Tisch des allzeit bereiten Konsumenten servieren die Medien gerne die Inflation. Doch so sehr diese offensichtlichen Urängste des zur Sparsamkeit erzogenen Menschleins immerfort aus ihm herausdrängen, ihn sozusagen über die rechtzeitige Erziehung «authentisch» machen, nicht zuletzt, da ebendiese Unterhaltungssendungen inflationär zunehmen, in denen vermutlich in Kürze viertelstündlich die Gold- und Silberkurse durch den Äther beinahe dauerfunken, es existiert dabei ein Widerspruch, den ich mangels psychologischem Einfühlungsvermögen nicht nachvollziehen kann — die inflationär produzierte Eigeninflation. Möglicherweise gibt es Verbindungen zwischen dem, das der Mensch nicht hat, und weshalb er sich ständig getrieben sieht, es zumindest virtuell in derartigen Massen zu fordern, daß sich bei der dann tatsächlich erfolgenden Forderungserfüllung selbst der Magen des allerärgsten Vielfraßes wegen Überfüllung in die Rotation begibt. Als Beispiele ließen sich Fernsehsendungen nennen, in denen es ums Kochen oder um die Liebe geht oder um nutzlose Gegenstände, die man zu verkaufen trachtet, um im Anschluß daran Gegenstände erwerben zu können, die garantiert nicht benötigt werden.
Zu diesen scheint sich eine weitere hinzuzugesellen: die Eisenbahn, gerne verpackt in dieses blümchenartige Geschenkpapier mit in der fernöstlichen Fabrik vorgefertigten Schleifchen namens Romantik, die sich dann in einer ähnlichen Logik präsentiert wie die Aufklärung im aktuellen chinesischen Kommunismus. Des Eindrucks kann ich mich nicht erwehren, je weniger Menschen mit der Bahn fahren, vielleicht weil es immer weniger nutzbare Strecken gibt oder dort, wo sie noch existieren, gar keine mehr hineinpassen in die Waggons, um so mehr sehnen sie sich nach diesem scheinbar nicht mehr existenten Verkehr auf den Schienen. Reichte es vor noch nicht allzu langer Zeit aus, dem nächtlich Einsamen die Position eines Lokführers anzubieten, von der aus er virtuell irgendwo von A nach B durch irgendeine Landschaft fuhr, so tuckern mittlerweile soviele Bähnleins durch die Fernsehlande, daß selbst wiederbelebte Geleise nicht ausreichen würden, diese Langsamreisen realiter durchzuführen. Mir wurde zugetragen, daß es sich bei den potentiellen Interessenten dieser meist technikspielerischen Bahnfahrten überwiegend um Menschen handeln soll, die sich im Ruhezustand des Lebens befinden.
Vor etwa fünfzehn Jahren bin ich nach einem langen Reifeprozeß zu jemandem geworden, der dieses Reisen mit Muße schätzen gelernt hat, nicht zuletzt auch deshalb, weil ich, im Gegensatz zum ständig irgendwo tunnelnden ICE oder dem in drei Stunden die Strecke Paris-Marseille durchzischenden TGV dabei etwas von Ländern und Menschen sehe und dabei hin und wieder gar von der Muse oder einer Mitreisenden geküßt werde. Das ist mit ein Grund, weshalb ich von der anfänglich genutzten ersten Klasse in die zweite umgestiegen bin. So ziehe ich es beispielsweise vor, für die Bahnreise vom Holsteinischen nach Berlin durch Branden- und Mecklenburgs Weiten zu rollen. Davon einmal abgesehen, daß trotz zweimaligen Umsteigens ich auch nicht später ankomme, als führe ich mit dem Expreß von Hamburg aus zur hauptstädtischen Zentralstation — ich sehe eigentlich nie Menschen meines Alters in diesen Zügen. Aber die reisen vermutlich nicht wie ich zu Zeiten, in denen sie Zeit hätten, allen anderen die Plätze zu überlassen, die diejenigen benötigen, die sich auf dem Nachhauseweg von des Tages Last ein wenig ausruhen möchten. Oder sie sitzen auf den vor drei Monaten und deshalb äußerst preiswerten bequemen Sesseln der Großraumwagen, bevorzugt karten- oder sonstwas spielend bei mitgebrachten Analogkäsebroten, und auch hier am liebsten während der Stunden des Berufs- oder Wochenendverkehrs. À propos: Auch hier scheint es Analogien zu geben — wer am meisten Zeit hat, geht dann zum Einkaufen seiner analogen Grundnahrungsmittel, wenn am meisten los ist in den Läden. Man möchte schließlich auch mal unter Menschen.
So sehe ich nächtlich einsamer, weil von unendlicher Müdigkeit und dennoch Schlaflosigkeit Malträtierter in zunehmendem Maße, wie immer mehr Menschen in hundert Jahre alten Bähnchen auf stillgelegten Strecken drängen. Offensichtlich kann es gar nicht eng genug zugehen, so gemütlich oder auch romantisch muß das sein. Oder sollte es dabei, um in die philosophische Dimension meiner Ansprüche zurückzukehren, andere Seinsursachen geben? Wer war zuerst da — die Bahn oder das Ei, das die Unterhaltungsindustrie gelegt hat? Was treibt die Herde Mensch derart gar in eigens dafür gebildete Schaukästen wie etwa dem hamburgischen Wunderland zusammen, daß sogar öffentlich-rechtlich pausenlos neue Strecken eröffnet werden müssen, derweil in der Wirklichkeit kaum noch ein Vorankommen ist (wobei nicht die berechtigten Streiks auf den privatisierten und deshalb lohndezimierten Bahnstrecken gemeint sind)? Hatten die Älteren während ihrer Kindheit mangels Masse keine ausreichende Gelegenheit, damit zu spielen? Müssen wegen dieser Verklärung einer nicht vorhandenen Erinnerung die Kleinen einen ganzen Nachmittag auf ihre Spiele am Computer verzichten?
Ich habe einen Traum — der Wutbürger demonstriert sich seine Welt zurück, in der er seine Eisenbahn wiedererhält, die in Staats-, also Steuerzahlerbesitz sich weniger um Gewinne und mehr um diejenigen bemüht, die sie als bequemes und, ja, auch das noch, umweltfreundliches Transportmittel benötigen. Dann kämen einige weniger tiefergelegte Bahnhöfe mehr zusammen, und die in kleineren Städten würden samt Toiletten und Fahrkartenschalter wieder in Betrieb genommen. Das wäre mal eine andere Maßnahme, für Arbeitsplätze zu protestieren.
Aber das ginge dann auch schon wieder in Richtung einer Inflation. Die der Nostalgie ist schließlich billiger.
| Mo, 25.04.2011 | link | (2482) | 18 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |
Selbsterkenntnis mit Laura
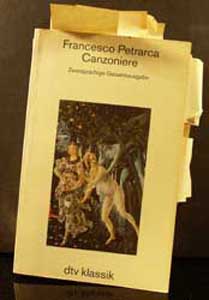 Des einige Zeit in der Nähe von Avignon dichtenden Italieners der frühen Renaissance und sicher bekanntester und bedeutendster Gedichtzyklus in einer zweisprachigen Ausgabe, die für den deutschsprachigen Raum ihresgleichen sucht: der Canzoniere. Der von Francesco Petrarca selbst ursprünglich unter dem Titel Rerum vulgarium fragmenta zusammengestellte Band enthält 366 Gedichte: 317 Sonette, vier Madrigale, sieben Balladen, 29 Canzonen und neun Sestinen.
Des einige Zeit in der Nähe von Avignon dichtenden Italieners der frühen Renaissance und sicher bekanntester und bedeutendster Gedichtzyklus in einer zweisprachigen Ausgabe, die für den deutschsprachigen Raum ihresgleichen sucht: der Canzoniere. Der von Francesco Petrarca selbst ursprünglich unter dem Titel Rerum vulgarium fragmenta zusammengestellte Band enthält 366 Gedichte: 317 Sonette, vier Madrigale, sieben Balladen, 29 Canzonen und neun Sestinen.Ihren großen Ruhm verdankt die Sammlung den Sonetten an Laura, deren zwei Gruppen den Hauptteil des Canzoniere bilden. Nach Gero von Wilpert prägten diese Liebesgedichte nach dem Minnesang des Mittelalters für mehrere hundert Jahre Stil und Wortschatz des «zweiten erotischen Systems der europäischen Kultur». Deutlich unterscheidet sich darin bereits das Bild der Frau von dem, das die Provençalen und die Dichter des dolce stil nuovo zeichneten, die die Frau als engelhaftes Wesen anbeteten und ihre äußere Erscheinung mit stereotypen Redewendungen beschrieben, meistens besungen von den von Burg zu Burg ziehenden frühen Laudatoren einer Liebe, die Körperlichkeit nicht kannte. Die Damen bestellten sie sich häufig vor die Balkone, um sich die Langeweile vertreiben zu lassen, die entstand, wenn ihre Ritter mal wieder zu einem christlichen oder anderweitigen Raubzug durch die Lande streiften. In ihrem Wertekanon hielten sich diese Balladen bis in die Wiederaufnahme des Liebesgeflüsters beispielsweise eines Cyrano de Bergerac etwa durch Edmond de Rostand; bis heute hält sich diese gerne als Romantik fehlbezeichnete geradezu spirituelle Entleiblichung.
Bei Petrarca ist die donna angelicata jedoch kurz davor, von ihrem Podest hinabzusteigen, die Statue des Pygmalion beginnt, Fleisch und Blut zu werden. Seine Laura bewegt sich in der irdischen Natur, entledigt sich gar ihrer Gewänder und badet im Fluß. Eine Wiedergeburt aus der auch körperlich lebhaften Antike bahnt sich an, wenn die frühe Minne auch noch immer wieder durchschimmert. Ihre Bewegungen, ihr Mienenspiel werden wiedergegeben, ihr Verhalten dem Dichter gegenüber ist abzulesen an den Stimmungen, die in den Sonetten evoziert werden. Die wahren Empfindungen der Geliebten werden nicht deutlich, es bleibt offen, ob sie die Liebe des Dichters erwidert und ob ihre Tugendhaftigkeit einem Mangel an Gefühl, einer grundsätzlichen Haltung oder nur natürlicher Scham zuzuschreiben ist. Diffus ist das zwar, aber ein Leben wird bei genauer Betrachtung erkennbar, das später als Beziehungslosigkeit in die Sprache der Psychologie einziehen wird.
Denn die Empfindungen Petrarcas sind ohnehin nicht als Liebe im herkömmlichen Sinn zu verstehen: dieser Liebende findet Erhebung in der Betrachtung der Schönheit und Tugend der reinen Frau; manches aus dem Wortschatz der Marien-Verehrung ist in seine Liebessprache eingegangen. Stärker jedoch als die religiöse Überhöhung kommt der Unmut des Mannes zum Ausdruck, der an der unmenschlichen Tugend und Reinheit der Frau leidet, die ihm keine Erfüllung gewährt, aber möglicherweise auch sein Leid darüber, daß er sich selbst immer auf Distanz hält.
Während Petrarca im ersten Teil der Gedichte in der lebenden Laura seinen eigenen Schmerz idolisiert, findet er allerdings im zweiten, in dem sich sein Seelenzustand nach dem Tod der Geliebten spiegelt, über die Erfahrung des wahren dolore amoroso zur Erkenntnis zutiefst menschlichen Leidens. Die kunstvollen Sonette des zweiten Teils, in denen mit reich variiertem Wortschatz die feinsten Nuancen einer melancholischen Lebensmüdigkeit, einer Zerrisenheit zwischen Liebe, Ruhmverlangen und christlicher Demut aufgezeichnet sind, gelten als die vollkommensten Gedichte des Canzoniere.
«Ich geh in Trauer um vergangne Zeiten,Radio DRS und Radio France (Auszug), Oktober 1993
in denen mich ein sterblich Ding verwirrte
und ich zum Flug, der mich dem Joch entschirrte,
die Schwingen, ach, versäumte auszubreiten.»[1]
Die erwähnte, sehr empfehlenswerte (ursprünglich in einem der letzten kleinverlegerischen Bastiönchen erschienene) Ausgabe ist — bedauerlicherweise — vergriffen (die 2002 bei Artemis und Winkler erschienene, von Hans Grote herausgegebene kann ich nicht beurteilen). Sie scheint sehr gefragt, genauer: kaum jemand mag sich von ihr trennen wollen; antiquarisch wird immer wieder mal ein Exemplar angeboten, aber häufig zu einem Preis, der um einiges über dem des dtv-Erstlings liegt, oftmals das doppelte und mehr. Das hat seinen Grund sicherlich auch in den Übersetzungen von Geraldine Gabor und Ernst-Jürgen Dreyer, der das Buch auch herausgegeben hat. Hier wird Laura ihres Astralleibes entledigt, bekommt die Magersüchtige der Anbetung Fleisch an die Rippen, die steinerne Aphrodite geschichtsabsenter Verzückung wird beatmet — was der sprachlich-bildhaften Schönheit dieses Werkes keinen Abbruch tut, sondern es eher aufwertet, da ihm das reine, idealistisch Abgehobene genommen wird. Nicht zuletzt der inhaltlich wie sprachlich brillante Kommentar bewegt den Canzoniere im Regal dort hin, wo er (auch) hingehört: ins Fach, in dem die Lyrik aussagebereit und -kräftig neben der Geschichte (nicht nur der Literatur) steht.
«— selbst Hannibal entschlüge sich des Spottes ...Dazu bei trägt das Buch mit seinen weit über tausend Seiten, das all dies eben nur in seiner Gesamtheit zu verdeutlichten vermag. Die Reduktion auf 50 Gedichte (384 Seiten) und in der Übersetzung von Peter Brockmeier, die Reclam aktuell anbietet, deutet allerdings auf eine Rezeption hin, nach der sich Petrarca als Troubadour, sich Laura als Liebesgöttin sehr viel größerer Nachfrage erfreuen denn als Geschichtsschreiber beziehungsweise als Figur der Renaissance. Hier scheint die Wahrscheinlichkeit nicht weiter von Belang, daß die engelhafte Blondine im richtigen Leben, im Avignon des 14. Jahrhunderts gar nicht existierte. Für viele Menschen scheint es auszureichen, lesen zu dürfen: «Du kühlst mich nicht, Canzone, du entflammst mich ...»
Schenkst du nur einen Blick dem Hause Gottes,
das heute gänzlich brennt, dann wird dir Kunde:
damit der Wunsch gesunde,
genügt es, Funken nur des Brandes, der tobte,
zu löschen, was man noch im Himmel lobte.»[2]
Dabei werden dann schon auch gerne Andeutungen überlesen, die auf Regungen verweisen, die dem Menschlein auch schonmal in die Glieder fahren.
«Talor m'assale in mezzo a'tristi piantiGlücklicherweise scheint jedoch auch Peter Brockmeier in der Reclam-Ausgabe dem Cliché der entleibten Liebe keine neue Nahrung zu geben (die offensichtlich allgegenwärtigen nachwilhelminischen Übersetzer-Wehen haben auch allzuzuviel Mißgeburten in die gesamte literarische Welt hinausgepreßt). In seinem Nachwort hält er fest: «[…] Der Konflikt zwischen Körper und Geist liegt auch der Liebesdichtung Petrarcas zugrunde; denn die Liebe ist ohne Sexualität nicht zu erfahren. Schon Augustinus hat von der Gottesliebe, der geistigen Liebe gesprochen und zugleich den Leser an die ‹fleischliche Umarmung› erinnert: Wenn er, Augustinus, Gott liebe, so sei dieser ‹das Licht, die Stimme, der Wohlgeruch, die Speise und die Umarmung meines inneren Menschen.›» (Buch von der Deutschen Poeterey, VI. Capitel.) Und — das läßt auch für die verschlankte Version des Canzoniere hoffen — der Emeritus der Berliner Humboldt-Universität Brockmeier deutet, ebenfalls im Nachwort, an, daß es sich bei diesem Werk wohl kaum um eines handeln dürfte, das eine Angebetete ihrem Ritter beim Hotelweekend unterm Eierbaum selbstgefärbt oder gar -gelegt ins Hasennest säuseln wird.
un dubbio: Come posson queste membra
da la spirito lor viver lontante?
Ma rispondemie Amor: Non ti rimembra
che questo è privilegio degli amanti,
sciolti da tutte qualitati humane?
Zuweilen stürmt im Weinen den Betrübten
ein Zweifel: wie denn können diese Glieder
so weit von ihrem Geist geschieden leben?
Entsinnst du dich, tönt Amors Stimme wider
daß dies das Privilieg ist der Verliebten,
die sich menschlicher Eigenschaft entheben.»[3]
«Francesco Petrarca, ein beflissener Leser der Bekenntnisse des Augustinus, hat die Form des Selbstbekenntnisses auf die Liebesdichtung übertragen: Er hat sich und sein Leben vor das Gericht eines erfundenen poetischen Ichs gestellt, um die Natur seines vergangenen liebenden Ichs zu ergründen. Die Liebeskunst seiner literarischen Vorbilder hat er in eine Gewissenserforschung verwandelt, die sich von der Faszination der Sünde nicht lösen kann. Das Lebensideal, das Petrarca dem Leser der Gedichtsammlung ansinnt, lautet: Lies und schreib, damit du dich selbst erkennst.»
[1] Ich geh in Trauer um vergangne Zeiten, p 953
[2] Ich wende mich zurück bei jedem Passe, p 35
[3] Es war der Tag, an dem die Sonne, ibid., p 157
Francesco Petrarca: Canzoniere
Zweisprachige Gesamtausgabe, nach einer Linearübersetzung von Geraldine Gabor und in deutsche Verse gebracht von Ernst-Jürgen Dreyer, nach der Ausgabe von Guiseppe Salvo Cozzo, Florenz 1904, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1990, 2. Auflage
Zur Petrarca-Monographie von Karlheinz Stierle einiges via Perlentaucher.
Siehe auch: Francesco Petrarca, Das einsame Leben.
| Fr, 22.04.2011 | link | (3044) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |
Homer im Schtetl-Universum
Einzelne Wörter der jiddischen Sprache sind auch im Deutschen geläufig, einige sogar in Gebrauch, ohne daß man sich um deren etymologische Herkunft Gedanken machen würde. Zum Beispiel erklärt sich manch einer für meschugge, tagtäglich malochen zu gehen — letzterer ein Begriff, der vor allem deshalb im Kohlenpott überlebt haben dürfte, weil die Bergleute sich unter Tage mit viel Freude erst an die Staublunge und dann in die Nähe eines früheren Todes gearbeitet haben. Auch heute noch kann ich diesen Gedanken eher weniger mit Spaß am Leben in Verbindung bringen. Aber früher war eben alles anders. Das erzählen einem zumindest gerne kluge öffentlich-rechtliche oder im bequemen Sessel der Zeitungsredaktion sitzende Menschen aus dem Westen, deren Ur- bis Ururgroßeltern aus dem Osten eingewandert sind. Zur Zeit deren Flucht vor der Armut in Polen gab es den Begriff des Wirtschaftsflüchtlings noch nicht. Mir ist auch nicht bekannt, wie der Wortschatz der ursprünglich rheinischen und später auch osteuropäischen Ashkenazim, also aus aus dem jüdischen Stetl in das Heer der katholischen Völkerwanderung gelangt ist. Normalerweise schätzt die eine Gruppierung die andere ja nicht sonderlich.

Sicher ist, daß diese Ostjuden in ihrer angestammten Heimat selbst das ärgste Schicksal noch lächelnd, weil gottgewollt, hingenommen haben. Die östlichen Ashkenazim stehen sozusagen geographisch im Gegensatz zu den Sephardim, die kurz vor der Wende zum sechzehnten Jahrhundert von den Katholiken aus Spanien vertrieben wurden (die allerdings nicht die orientalischen Juden sind, als die sie häufig fälschlich bezeichnet werden). Sie sind es, die in den letzten Jahren verstärkt in erster Linie Rußland verlassen haben und nach Israel, aber mittlerweile auch nach Deutschland ausgewandert sind; sie haben erheblichen Anteil an den wieder wachsenden jüdischen Gemeinden, in denen sie oftmals Siedlern der Westbank gleich für die Wiederherstellung althergebrachter Glaubensrituale sorgen. Mit ihnen kann man sich durchaus auch heute ohne russische Sprachkenntnisse verständigen — vorausgesetzt, man hat einen der nach wie vor beliebten Jiddisch-Kurse an einer Volkshochschule oder direkt bei der US-amerikanischen Frau Rebbe in deren neumodischem Kiez belegt. Oder man hat es in seiner Kindheit gelernt, um einen Vater zu verstehen, der manchmal in solch einen seltsamen Sprechgesang verfiel, wenn der seine Gefährtin ärgern wollte, die dieser Proletensprache zwar mächtig war, sie aber auf den Tod nicht ausstehen konnte, weil sie so kunstfeindlich unzivilisiert war.
Dieser Vater hat seinem Sohn hin und wieder mal Geschichten aus seiner Heimat erzählt, und zwar in dieser Sprache, in der auch mit der Verwandtschaft in Nahost und manchmal auch in Amerika gesprochen wurde. Es waren oftmals mündliche Überlieferungen darunter, die gesammelt und später aufgeschrieben wurden. Das war in etwa das, was die Gebrüder Grimm mit den Märchen gemacht haben, die ihnen häufig zugeschrieben werden, sicherlich nicht zuletzt deshalb, da die Philologen Jacob und Wilhelm sie einer hochsprachlichen Vereinheitlichkeitsübersetzung unterzogen haben. Dieser Vater aber, der hat nichts moralisierend behübscht, schon gar nicht in der Weise, in der beispielsweise die Operette vulgo Musical diesen Fiedler auf dem Dach in Anatevka verpeinlicht hat. In den originalen Mythen war die kleine Welt bereits so komisch, daß ihnen nicht auch noch Witzchen angeklebt werden mußten, die auch wirklich jeder Kulturkreisfremde verstand.
Nun kam mir dieser Tage ein Buch aus meinem regalen Leben entgegen, das ich gerne verhyperlinkend empfehlen würde, doch es scheint nicht mehr erhältlich. Es handelt sich dabei um Jiddische Erzählungen. Darin ist teilweise enthalten, was manch ein jüdischer Schriftsteller aus seiner Denk-Sprache direkt in die Schrift hat hineinklingen lassen. Denn der dieser Mentalität ureigenartiger Witz funktioniert am ehesten in seinem Idiom — soweit das überhaupt schriftlich lesbar zu machen ist und man nicht ausnahmsweise zum sogenannten Hörbuch greifen muß. Zu den Klassikern dieser eigenen Literaturgattung gehören Scholem Alejchem, Jizchak Lejb Perez und Mendele Mojcher Sforim, von denen Leo Nadelmann dreizehn Geschichten ausgewählt und übertragen hat.
Allein Die Reisen Benjamin des Dritten von Mendele Mojcher Sforim belegen diesen skurrilen Humor und hintergründigen Witz. Erzählt wird von Benjamin aus dem verschlafenen Nest Tunejadowka, den das Reisefieber packt. Gemeinsam mit dem gutmütigen Einfaltspinsel Senderl, einer Art jiddischem Verwandten im Geiste des Schweijk, macht er sich auf nach Erez Israel, ins gelobte Land. Doch nicht dort, sondern in einer Kaserne der Zarenarmee landen die beiden, weil sie von Glaubensbrüdern als Söldner verschachert wurden.
Auch die anderen Erzählungen sind außergewöhnliche Unterhaltung mit eben diesem tiefgängigen Humor, der stellenweise philosophische Dimensionen vereinfachend verrückt. Das sind Menschen wie zum Beispiel dieser Georg Chaimowicz, die eine schweinerne Bratwurst deshalb genüßlich meterweise runterkauen, weil sie fest daran glauben, es wär' a Fisch. Auch Albert Einstein fällt mir dabei ein, der in meinem Familienbesuch auf die Frage nach dem lieben Gott antwortet, daß er den nicht brauche. Solche Geschichten zu erzählen ist kein WDR- oder WAZ-Chronist in der Lage. Das können nämlich nur diese Homers aus dem Schtetl-Universum.
| Di, 19.04.2011 | link | (10056) | 14 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |
|
|
Jean Stubenzweig motzt hier seit 6421 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00
... Aktuelle Seite
... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)
... Themen
... Impressum
... täglich
... Das Wetter
... Blogger.de
... Spenden
Zum Kommentieren bitte anmelden.
Suche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
AnderenortsSuche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
Andere Worte
Anderswo
Beobachtung
Cinèmatographisches + und TV
Fundsachen und Liebhaberstücke
Kunst kommt von Kunst
La Musica
Regales Leben
Das Ende
© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig
