Beschwingte hanseatische Anglophilie
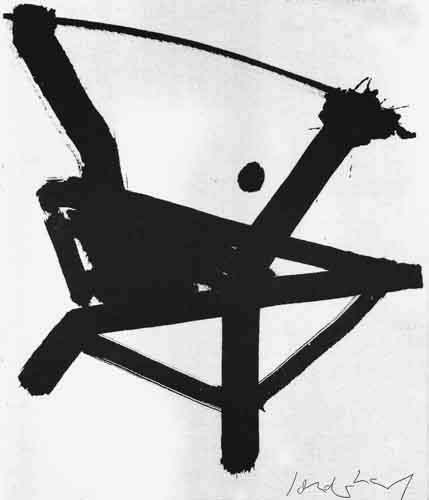
Einen Künstler gab es, den ich nicht nur seiner Malerei, sondern auch wegen seines geradezu ungemein gelassenen (hanseatischen?) Humors oder auch saloppen Mundwerks sehr schätzte; die Arbeit eines Informel-Kollegen, der mich in dessen fortgeschrittenem Alter äußerlich bisweilen ein wenig an einen hart am Aufstieg in die geistige Aristokratie geschuftet habenden Sekundäradeligen erinnerte, bewertete er in einer Kneipe (s)einem Weggefährten und mir gegenüber mal kurz und knapp ungefähr so: Ach hör mir doch auf, das ist doch gotischer Grottenkitsch. Zu für ihn noch fröhlichen, weil wanderungsaktiven Lebzeiten, damals in einem seiner vielen weltweiten Standorte, hier der engen, aber dennoch feinen Wohnung in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung, erzählte er mir zum ersten Mal davon, wie bedrückend es doch sein kann, wegen Anglophilie in den Knast gesteckt zu werden (heutzutage wären die Straßen vermutlich menschenleer). Zu der Zeit stand dieser Begriff allerdings primär als Synonym für eine Musik sowie einen Lifestyle, die kurz nach unserem Gespräch als Schallplatte mit ausstellungsbegleitendem Katalogbuch dokumentiert werden sollte: Von den Swingboys plauderte damals Kurt Rudolf Hoffmann, geboren im dänischen Sønderborg, und wie nebenbei von seiner Gestapo-Haft. Noch kurz vor seiner Entlassung war ein Schreiben Himmlers an Heydrich ergangen:
«Anliegend übersende ich Ihnen einen Bericht, den mir Reichsjugendführer Axmann über die Swing-Jugend in Hamburg zugesandt hat. Ich weiß, daß die Geheime Staatspolizei schon einmal eingegriffen hat. Meines Erachtens muß aber das ganze Übel radikal ausgerottet werden. [...] Der Aufenthalt im Konzentrationslager muß länger, 2–3 Jahre sein. Es muß so klar sein, daß sie nie wieder studieren dürfen.»Hans Platschek, K.R.H. Sonderborg: Eine Vorgeschichte, in: Kat. K.R.H. Sonderborg, XPO Galerie, Hamburg 1985, S. 6ff.
Beim Schürfen in den scheinbar weißen Flecken meiner Kartonlandschaften stieß in nun, ausgelöst nicht alleine wegen der Findungsmaßnahmen aufgrund meines zweiten Festplattendesasters, auf diverse ältere Quellen. Dabei kamen mir ein paar Blätter entgegen, die sich in dem Zettelkasten befunden haben müssen, den mir der freundliche, aber auch bequeme oder auch von Papierkram ziemlich angewiderte Mensch seinerzeit zum Studium seiner Vergangenheit überlassen hatte. Die Mühe kleinerer schriftlicher Hinterlassenschaften hat er sich dann doch nicht nehmen lassen.
In einem Spottvers für die Repressionen gegen die Swingmusik wird Goebbels verantwortlich gemacht:
Der kleine Josef hat gesagt, ich darf nicht singen,Zu Joseph, Joseph gesungen heißt es auch:
denn meine Band, die spielt ihm viel zu hot.
Ich darf jetzt nur noch Bauernwalzer bringen,
nach dem bekannten Wiener Walzertrott.
Wir sind nicht Juden, sind nicht Plutokraten,
doch die Nazis müssen trotzdem weg.
Aus uns da macht man keine Soldaten,
denn unsere Hymne ist der Tiger Rag.
Ich muß annehmen, daß die Tanzerei im Hamburger Stadtteil Barmbek stattgefunden hat:
Wir tanzen Swing bei Meier Barmbeck.Auch diese Notiz lag noch dabei: Frei nach dem ‹Lambeth Walk›, der Churchills Lieblingslied war und daher an oberster Stelle auf dem Index der verbotenen Lieder stand.
Es ist verboten. Wir hotten nach Noten.
Und kommt die Polizei, dann tanzen wir Tango.
Und ist sie wieder weg, dann swingen wir den Tiger Rag.
Kennen Sie Lamberts Nachtlokal?
Nackte Weiber kolossal
Eine Mark und zehn, liegen oder stehn!
| Di, 06.09.2011 | link | (3734) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ohrensausen |
Revoluzzionäre Kulturauflösung
«Ein Überohr ist kein Überbein. Vielmehr könnte man denken, daß ein Überohr eine Art musiktheoretischer Übervater ist. Etwa der alte Musiklehrer aus der Oberstufe, der als Mann im Ohr in einem fortwirkt. Ein Überohr scheint ein Organ zu sein, mit dem sich über den Musikgeschmack wachen läßt — den eigenen wie den des Zeitgeists.Wer sich hinter diesem Pseudonym verbarg, erfuhr ich erst Mitte der siebziger Jahre. Das hatte sicherlich damit zu tun, daß ich zuvor zwar auch, aber nicht so intensiv U hörte, da mir die als elterlich-pädagogischer Ernst des Lebens injizierte Droge E kindheitsgeprägt so beharrlich durch die Synapsen floß wie anderen die Rosenkränze aller erdenklichen Religionen. Sounds gehörte demnach nicht unbedingt zu meiner nächtlichen Hotelschubladenlektüre. Das war war eher das Revier solcher Rebellen wie Hans Pfitzinger, der für das Rock'n'Roll-Blatt von San Francisco aus hin und wieder musikalische Depeschen ins östliche Übersee kabelte, wie überhaupt etwa die Beat-Dichter oder Love and Peace sein Thema waren. Aber als der mir eines Tages erklärte, daß dieses überdimensionale Ohr nicht nur Unterhaltung kannte und konnte, sondern für mein Verständnis auch Ernsthaftes äußerte, da war ich dann doch ein wenig überrascht, war mir Helmut Salzinger bereits seit längerem bekannt. Er gehörte mit zu den ersten, die sich mit dem 1967 erschienenen und später legendär werdenden, ziemlich dicken und von mir heute völlig zerlesenen Taschenbuch der Wiener Gruppe beschäftigten. Dort fühlte ich mich eher beheimatet.
Ein solches Organ gab es tatsächlich. Es stammte natürlich von keinem Musiklehrer. Schon gar nicht in den frühen 1970ern, wo obrigkeitsstaatlich noch streng zwischen Hoch- und Trivialkultur geschieden wurde, zwischen U und E. Es kam vielmehr aus Hamburg und nannte sich Sounds. Mit Sounds verlor die Trivialkultur ihre Trivialität und wurde zur Popkultur geadelt.»
Andererseits waren die Entfernungen dann doch wieder nicht allzu groß, oder aber: Die Grenzen zwischen Unterhaltung und Ernst hatten begonnen, zu zerfließen, hatten auch bei mir bereits Auflösungserscheinungen gezeigt. Die Wiener um den gleichnamigen Vater einer heute so erfolgreich das Fernsehen bekochenden Tochter mit alttestamentarischem Namen hatten spätestens seit Mitte der Sechziger die Trampelpfade der eindimensionalen Menschheit verlassen, waren mit Vorbereiter dessen, was ab '68 endgültig als Muff aus tausend Jahren aus den Talaren gedampft werden sollte. Gemein war alldem der jeweils schlechte Einfluß auf junge Menschen, die schließlich arbeiten oder studieren sollten und nicht revoluzzern oder gar revolutionieren. Was letztlich daraus werden sollte, ist bis heute sichtbar am Beispiel der sich innerhalb der Grenzen Europas hartnäckig haltenden Kriminalitätsvorbeugung titels Schleyerfahndung.
Ernsthafter Kinderkram also. Und selbst der ist ursächlich zurückzuführen auf die Wiener Gruppe, die es nach Friedrich Achleitner als solche nie gegeben hat, war sie es doch, wie mir mal ein Jazzmusiker aus deren Umfeld nächtens bei anderen Drogen ins Unterohr balladierte, die die alte Revolution nach- und die dann kommende quasi vorspielte. Auch den hier kürzlich erwähnten Niedergang einer Illustrierten hatten die Wiener bereits vorgezeichnet. Ein Reporter des Bildblattes wurde seinerzeit tief unten in den Kellern der Kaiserlichen und Königlichen Metropole wegen seiner Verbreitung von wirklichen Unwahrheiten von einem Volksgerichtshof zum Tod durch das Fallbeil verurteilt. Man ließ ihn zwar wieder frei, aber die Revolution war immerhin eingeläutet. Jedenfalls als Terminus technicus der Werbeindustrie. Nicht nur der Popokultur.
| Di, 30.08.2011 | link | (3202) | 7 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ohrensausen |
(Musik-)Experten für die Altenpflege
Zwar behaupte ich gerne, mit zunehmendem Alter kehre zwischenzeitlich wenigstens meine Langzeiterinnerung zurück. Doch seit ich überhaupt keine Stoffe aus Drogerien mehr zu mir nehme, scheint mich auch noch das Kurzzeitgedächtnis zu verlassen. Irgendetwas drängt mich zunehmend aus der Mitte (des Lebens?). Also nehme ich einfach mal so Altenpflege aus meinem kleinen, um so geschätzteren Lesezirkel in Anspruch.
Irgendein abendliches Kunst-TV-Magazin ging gestern aus sich und dem Programm heraus mit einem zweiundzwanzigjährigen Sänger von der Insel der Angeln und Sachsen. Dessen Namen habe ich, wie zu erwarten, bereits wieder vergessen. Sein Vortrag allerdings ist bereits seit den ersten Takten und seiner Stimme wegen in meinen offensichtlich gerade noch verbliebenen Windungen hängengeblieben. Vermutlich eher weniger wegen dessen Musik, sondern mehr, weil sie sofort eine (durchaus positive) Erinnerungsstarre in mir auslöste. Da gab es nämlich einen US-Amerikaner, dessen sinistre Balladen sogar mich der Popularmusik eher Abgeneigten Anfang der Achtziger derart ergriffen, daß ich mir seine beiden Schallplatten kaufte, die ich immer und immer wieder abhörte. Doch nicht nur der Name des Jüngeren ist mir entschwunden, ebenso der dieses Urhebers, den ich nun suche, obendrein auch dessen Vinylscheiben, so daß ich nicht mehr nachschauen kann, wie er hieß. Ja, richtig: hieß. Denn das ist das einzige, das mich an diese Personalie erinnert: Irgendwann in jungen Jahren stürzte er nämlich mit einem Flugzeug ab, dunkel schwant mir, es müsse ein kleines gewesen sein, für das er eigens einen Pilotenschein erworben hatte, er seine Klänge also alleine mit in die Hölle genommen hat, an deren Vorhof ich immer dachte, wenn er mit fast unterdrückter, aber möglicherweise gerade deshalb ausdrucksstarken Stimme seine Klagelieder sang. Vom Klang her wäre eine entfernte Nähe zu Tom Waits zulässig, aber nicht so verraucht-kneipig, denn diese Lieder unterschieden sich in ihrer dramatischeren Erzähltechnik musikalisch erheblich, da waren wesentlich mehr sängerische Kunstfliegereien enthalten.
Ob mir jemand zu meiner Erinnerungs verhelfen kann? Und sollte jemand gestern auch an diesem Kulturmagazin hängengeblieben sein, von dem ich eben ebenfalls nicht mehr weiß, welches es war, dann könnte er mir vielleicht auch noch den Namen des jungen Insulaners von der Alten Welt nennen.
| Di, 01.03.2011 | link | (5263) | 15 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ohrensausen |
Überkreuzfahrten der popolairen Weltmusik
Hätte Mozart nur ein bißchen vom Geschäftssinn eines Eberhard Schoener besessen, er wäre nicht völlig verarmt verscharrt worden. Doch im Einstreichen dürfte der deutsche, mittlerweile offenbar alles Niedergeigende ohnehin eher einem anderen, quicklebendigen, hier oberen Österreicher namens Karajan mental verwandt sein. Das ist keine schlechte Voraussetzung, in die Musikgeschichte einzugehen. Zumal die Medien ihm dabei tatkräftig unter den taktführenden Arm greifen.
So entstand im Vorjahr seine Klassik-Rock-Nacht in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk — mit sechs Stunden eines der am längsten andauernden Popkonzerte, das jemals vom deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde und das in halb Europa zu sehen und zu hören war. Am 9. Dezember (1981) sind für Schoener sämtliche dritten Programme reserviert, im Radio gibt's den Stereoton dazu, und immerhin sieben Eurovisions-Stationen übernehmen live die 2. Klassik-Rock-Nacht aus dem Münchner Circus Krone. Als Ouverture wird Bachs Violinen-Solo Chaconne ertönen, gestrichen von dem zweiundsiebzigjährigen Jazzgeiger Stéphane Grappelli. Das eigentliche Gefecht zwischen Bach und Beat findet jedoch unter der Stabführung des hageren Lockenkopfs zwischen Rockgrößen wie Peter Gabriel und John Anderson (Yes) statt. Vangelis läßt elektronische Regenbogen über Joachim Kühns Jazzpreludien steigen, und Esther Ofarim singt über ihre neuen Frühlingsgefühle.
Einen Monat später geht der Schoener Eberhard auf eine Tournee durch neun Städte. Unter dem Programmtitel Video Magic in Concert bietet er hundertzwanzig Monitore, sechzehn Musiker, einen Pantomimen, Laser aus der Atom-Steckdose sowie diverse Videoträume und Opernreminiszenzen. Das Glückgefühl, das aus diesem üppig gefüllten Horn über die Zuschauer klanggegossen wird, hat die New York Times mal so formuliert: «Wie auf der Milchstraße zwischen explodierenden Sternschnuppen.» Ein wenig liest sich das wie ein Satz, der sich nach Douglas Adams sehnt.
Manche halten den Schoenen für den Köhnlecher des Klanges. Doch der Erfolg spendet ihm unerschütterliches Selbstbewußtsein: «Meine Platten gibt es inzwischen in siebzehn Ländern. Die LP Bali-Agung wird in New Yorks makrobiotischen und vegetarischen Läden als Meditationsmusik verkauft.» Abgerechnet wird direkt mit Manhattan und, das ist das Wesentliche, nicht etwa über das vertrackte Vertriebssystem des US-amerikanischen Phonohandels, sondern direkt mit den Reformkosthändlern. Das darf die Entdeckung einer Marktlücke genannt werden.
Das Ei des Kolumbus will der Komponist im Februar nächsten Jahres ausbrüten. Dann dampft Eberhard Schoener mit Filmteam, Orchester und Solisten nach Mexiko ab. Auf dem sanften Berg einer aztekischen Opferstätte soll ein Konzert ohne Zuhörer stattfinden. Wo streng religiöser Kult jegliche Veranstaltung mit Publikum verbietet, werden bei sanftem Sonnenuntergang geheimnisvolle Klänge für Götter und elektronische Konservendosen gen Himmel steigen. Der Trip ins Land der Inka dient außerdem der Jagd auf Peyote. Dieser pilzförmige Kaktus, aus dem die Droge Meskalin gewonnen werden kann, wird nach einem heidnischen Ritual mit Pfeil und Bogen erlegt. Schoener kultiviert die Beute zu einer neuen Platte. Denn Mariachi, das etwas anders als afrikanisch klingende mexikanische Volksmusikgebläse, hat der Bali- und Bangkok-Experte noch nicht in seinem Repertoire des Verkaufbaren.
Das Problem dieses Mannes mit tausend und einer Idee: «Was bin ich? Die Leute wissen nur, daß ich alles mache. Aber sie wissen nicht genau, was das alles ist.» Um aus diesem Dilemma herauszukommen, wurde eine Werbeagentur gesucht, um dem Multi-Media-Virtuosen ein ihm angemessenes Image zu verpassen. Ein dreijähriger Aufbauplan sieht vor, den Namen Schoener als Begriff zu etablieren wie etwa Beuys oder Warhol und auf diese Weise «Nachfrage beim Endverbraucher zu schaffen».
Der tapfere und kregelige Schwabe Schoener streicht derweil siebenfach: als Dirigent, Komponist, Künstler, Produzent, Regiseur, Texter und Verleger. In seiner Freizeit züchtet er Schafe am Tegernsee und keltert eigenen Rosé auf Elba. Den Rausch holt sich der feinnervige Asket allerdings lieber aus Hollundersüppchen nach altbayerischen Rezepten. Solchermaßen aufgeputscht produziert er in seinem Studio mit Blick auf den Wendelstein «geistiges Haschisch».
Das sind recht verblüffende Entwicklungen für einen jungen Violinisten, der 1964 aus dem Orchestergraben der Bayerischen Staatsoper kletterte. Zunächst gründete er ein eigenes Jugend-Symphonieorchester und inszenierte Freiluftopern im Brunnenhof der Münchner Residenz. Doch als er sich mit Elektronik zu beschäftigen begann, da ging's dann in höhere Sphären.
Die englische Gruppe Procul Harum von A Whiter Shade of Pale exerzierte vor, was Schoener mit dem Deep Purple-Keyborder Jon Lord auf der gemeinsamen Platte Window nachmachte: Rock meets Classic, eine Kombination, für die der Deutsche später auch noch Musiker wie Sting und Andy Summers, die gerade dabei waren, sich zu einer Police-Einheit zu formieren, Andy Mackay (Roxy Music), Darayl Way (Curved Air) und den Orchester-Zauberer Mike Batt gewinnen konnte. Nebenbei richtete er mit Wilfried Minks das BMW-Museum in München ein, das bereits die beachtliche Einschaltquote von einer halben Million Besucher eingebracht hat.
Nun soll ihm die weiß-blaue Autoschmiede auch beim Aufbau einer eigenen Kabelstation behilflich sein, auf daß diese Zukunftsmusik für Schoener schon 1985 wahr wird. Bis dahin wird auch jene Ware fertig sein, mit der er die Unterhaltungsbranche bereichern will: tönende Videobilder, die die herkömmlichen Schallplatten ablösen. Ein Spiel ohne Grenzen, und die deutsche Electrola fröhlicht mit. Plattenchef Wilfried Jung zu diesem Phänomen: «Es gibt gegenwärtig nur zwei Musikleute in Deutschland, auf die man setzen kann.» Meine Frage an den mir gegenübersitzenden Einen: «Wer ist der zweite?» Seine wie (fast) immer charmant gelächelte Entgegnung: «Sagen wir mal so, der letzte war James Last.»
Flohmarkt: Savoir-vivre, 1981
| Mi, 05.01.2011 | link | (3602) | 9 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ohrensausen |
Knödelnde Kauboys
erobern am 25. November (1978) die Jahrhunderthalle in Frankfurt-Höchst. Bands und Barden kommen freilich nicht aus dem Holy-Filterkippen-Land, sondern eben aus deutschen Landen auf den Tisch. In Ausscheidungskonzerten von Hamburg bis München haben die Veranstalter insgesamt hundertzweiundzwanzig Bewerber gesiebt. Die Gruppe, der am meisten applaudiert wird, fliegt für zwei Wochen nach Nashville, in die Metropole der Country- und Western-Orchester. Den Flug stiftet die deutsche Zigarettentochter, die ihre gefilterten US-Glimmstengel in Deutschland mit Freie-Welt-Romantik zur Marke des männlichsten Mannes rollen konnte und damit für höchsten Wohlklang wenigstens in den Kassen sorgte.
Der Reklame-Rummel hebt ins Rampenlicht, daß Bundesdeutschland innerhalb von dreißig Jahren eine Western-Kolonie geworden ist. Seit der US-amerikanische Soldatensender AFN seine singenden Kuhhirten in der Alpenregion, am Rhein und an der Spree reiten läßt, hat sich hierzulande allmählich eine Hillbillie-Folklore entwickelt: Mittlerweile bewohnen die Deutschen das sangesfreudigste Country außerhalb der Staaten. Es hat den Anschein, als träte bald ein neuer Stern neben die Streifen der Flagge.
Schon 1977 schwappte die Trendwelle über den großen Teich zurück. Die beim Nashville-Festival bejubelte Truppe Truck Stop kam vom harburgischen Seevetal. Mittlerweile verbreitet die Musikalienfirma Bear Family in Bremen sogar den falschen Mythos, daß der Vorsänger Johnny Cash, seinerzeit GI in Deutschland, in den fünfziger Jahren hier im Osten erstmals Gitarre geklampft hätte. Wahr ist, daß um diese Zeit — ohne Cash — die deutsche Westlandlied-Szene in Bewegung geriet. 1956 gründete der Schweizer «Chuck» Steiner die Zeitschrift Country Singin' & Pickin' News, die unter dem Titel Hillbilly heute noch erscheint. Im Beatles-Jahr 1963 trafen sich dann die auf Western-Art fiedelnden und Banjo zupfenden Deutschen beim ersten Country & Western Festival in Neu-Südende bei Oldenburg, wie seither jedes Jahr zu Pfingsten. Dort wurde auch Country Corner initiiert, eine Zeitschrift, die unsere Provinz über die Volksmusik der Nordamerikaner zwischen Maine und Kalifornien unterrrichtet und im Süddeutschen Rundfunk mit ihren Mitarbeitern eine gleichnamige Sendereihe bestreitet.
Mittlerweile sind deutsche Kuhmusik-Freunde nicht mehr auf die ärmlichen zwei Stunden angewiesen, die der Soldatenfunk American Forces Network, bekannter als AFN, täglich dudelt. Deutschsprachige Sender, wie etwa Österreichs ORF, die schweizerische SRG sowie das Rödel-Radio Luxemburg, musizieren sechsundvierzig Stunden monatlich im westlichen Stil. Der gerne auch als der «häßliche» bezeichnete Hessische Rundfunk ermittelte per Hörerumfrage vom März 1978 die beliebtesten Country-Interpreten: Neben Johnny Cash und Emmylou Harris kam Deutschlands Truck Stop auf die vorderen Plätze. Mit deutscher Heimarbeit füllten die Seevetaler Fiedler und Trommler des Gülledufts bereits zwei Langspielplatten. Konkurrenten sind die Emsland Hillbillies und deutsch-amerikanische Freundschaftsformationen wie Canned Leather, während der geübte Trendreiter James Last mit seiner Scheibe Western Party dazu die flashige Barbecue-Soße liefert. Ein noch autarker deutscher Plattenhersteller hat sich Johnny Cashs Stieftochter Rosanne weltexclusiv eingefangen, und inzwischen singt sogar schon die Griechin Nana Mouskouri Westernballaden der Deutschen auf deutsch. Nicht zuletzt schürft im hiesigen Country-Claim ein Gunter Gabriel, der gerne Texte des Tausensassas Shel Silverstein nölt, und Volker Lechtenbrink geht mit eingedeutschten Liedern von Kris Kristofferson auf den Treck.
Deutsche Plattenfirmen und prachtvoll ausgestattete Töchter US-amerikanischer Record Companies haben erkannt: Hier gibt's noch manche Scheibe runterzuschneiden. Stagnierte der Marktanteil der Landluftmusik in der BRD bis vor zwei Jahren noch bei einem Prozent, melden einige der Verkäufer mittlerweile das Fünf- bis Zehnfache. Deshalb gibt es jetzt schon Spezialisten wie das Nashville Music Studio in Leverkusen, dessen Musiker auf den spezifischen Klang der Steelguitar geeicht sind.
Der Kommerz entdeckt eine Klientel, die sich längst gut organisiert hat. So veranstaltet der fünfundvierzigjährige Walter Vogelstein aus Ingolstadt mit seinem Country Music Club Bavaria jetzt zum sechstenmal eine Pilgerfahrt nach Nashville. Aus Wien bedient Country Music Informations die Begierigen mit Platten-Bestellnummern, Liedtexten, Musikanten-Biographien und Lteraturangaben. Vom Münchner MUH bis zum Hamburger Klub Country Castle drängen die Westerner ins folkloristische Programm von etwa sechzig Bühnen.
The best of deutscher Westliedkunst ist (für zwanzig Doller Jahresbeitrag) Mitglied der in Hollywood gegründeten Academy oft Country Music. Die Mitgliedsnummer 2608 ziert den dreiunddreißigjährigen Beamten Manfred Vogel aus 2584 Zwesten 3, der hat vorbeugend von drüben einen Stapel Blankoausweise mitgebracht. Er rechnet eben fest damit, daß nach dem Frankfurter Festival diese Musik zum nationalen Kulturgut ausgerufen und damit die Zugehörigkeit zu Good's own country endgültig besiegelt wird.
Flohmarkt: Savoir-vivre, etwa zum Weihnachtskaufrausch von 1978
| Do, 23.12.2010 | link | (4676) | 9 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ohrensausen |
Genuß- und andere Fähigkeiten im Neuen
So manch schönes Vorurteil stößt seine erste Silbe ab, wenn die Erfahrung einmal über es gekommen ist. Oder so: Hin und wieder erweist es sich als Lebenshilfe, grundsätzlich mißtrauisch zu sein. Noch anders: Zunächst wollte ich mich dazu gar nicht äußern, obwohl es mich schon sehr hat den Kopf schütteln lassen, zumal es nach kaum zur Kenntnis genommenen Andeutungen anderswo nun nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern gar kommentiert wurde. Es hat den Anschein, als ob es der Andeutung der intellektuellen Großmeisterei bedurfte, hinter der sich bekanntlich immer ein großer kluger Kopf verbirgt. Die Mauselöchlein öffneten sich, der Berg begann zu kreisen, und katzengleich begab sich die meinungsstarke Bloggergemeinde in den Speakers Corner der Kultur und behauptete ihr reserviertes Eckchen im Hyde Park. Denn endlich hatte es mal einer gesagt: Im Keller brennt Licht.
Einige Tage zuvor hatte ich anderswo über Neue Musik gelesen, es jedoch als altbackene Nichtigkeit abgeschüttelt: «Überflüssig. | Nicht, dass sie keine Ziele erfüllen würde. | Die Generalmusikdirektoren können damit ihre Progressivität unterstreichen, Opernhäuser ihre Weltoffenheit, Konzertgeher ihre Connaissance, Orchester ihre Unvoreingenommenheit ... und nicht zuletzt verdienen ein paar spinnerte Komponisten ihre Brötchen damit. Ist ja auch nichts Neues. | Nur eines tut niemand mit der Musik: niemand würde sie sich freiwillig am Samstag nachmittag in die Stereoanlage legen und sich ein paar Stunden davon berieseln lassen.»
Ich tue so etwas, dachte ich so für mich hin. Aber ich bin ja auch ein Niemand. Und ein Jemand ist man erst dann, wenn man hört, was alle hören, oder das sagt, was alle sagen. Oder so ähnlich. So empfand ich des weiteren, nachdem ich ein paar Tage später gelesen hatte, was ich eigentlich ebenso unkommentiert in seinem Sein belassen wollte. Aber irgendwie war ich dann doch zu überwältigt von solch aussagekräftiger Meinung:
«Bravo. Ich sag's und schreib's seit Jahrzehnten in meiner kleinen Musikerwelt. Drum: Danke. | Free-Jazz & ‹Free Music› sind so ähnliche Krankheiten, die Sie sich mal vorknöpfen könnten.»
Er selber, seines Zeichens Musikverleger, tut's nicht. Er bittet jemanden darum, von dem er weiß, daß ihm Neue Musik und so'n Kram halt zuwider ist. Zur allgemeinen Erheiterung schiebt er noch ein Witzchen für die Nicht-Elite nach: «Hat hier wie nebenan noch keiner angemerkt ‹Geschmäcker sind verschieden›? Schade, denn dann kann ich nicht den schönen Satz anbringen: Das sagen immer die, die keinen haben.» Das hat die Würze von Currywurst mit Champagner. Aber bitte, warum nicht. Wer's mag, hat mir der Altbayer beigebracht, für den ist's das Höchste. Womit zumindest eine Gruppenzugehörigkeit nachgewiesen wäre. (Soeben stelle ich fest, daß er sich auch in seinem Eigenheim zu dem Thema geäußert hat.)
Es gab auch leichte Moderationsversuche. Von außen. Einer davon war dann gar präzise:
«Die Grenze wird dort überschritten, wo behauptet wird, diese ganze Musik sei sowieso nur ein einziger Bluff. Eigentlich würden auch die, die sich so etwas gerne anhören, das insgeheim scheußlich finden und sich das nur des Distinktionsgewinns wegen antun. Das ist dann ungefähr so, wie wenn ein Dreikäsehoch behauptet, die Erwachsenen würden nur deshalb so Sachen wie Zwiebeln oder Roquefort essen, weil sie sich von den Kindern abgrenzen müßten, in Wirklichkeit würde sie insgeheim nach Nudeln mit Ketchup lechzen.»
Das hat mir, der ich zugestandenermaßen den immerzu wähnenden Zusammenhängen verfallen bin, besonders gut gefallen. Sicherlich hat es damit zu tun, daß in meiner engeren Umgebung Kinder nicht nur Hummer streicheln, sondern sie auch essen, wie überhaupt alles — ausgenommen diesen mit Affenzahn in ihnen verschwindenden und gleich wieder hungrig machenden US-Weichfraß. «Genußfähigkeit», faßt der oben Zitierte das Wesentliche zusammen, «egal welcher Art ist das Resultat von Arbeit. Es erfordert Auseinandersetzung mit der Materie, ob es nun um's Essen, Kunst oder Musik geht.» Er muß sich dann allerdings noch erklären: «Arbeit ist für mich nicht Mühe und Plage, die Strafe für die Ursünde, sondern sie ist einfach Auseinandersetzung mit einem fremden Gegenstand, der mir, weil fremd, einen gewissen Widerstand entgegensetzt. Zwar ist die Überwindung dieses Widerstandes oft etwas mühselig, andererseits aber auch äußerst befriedigend, denn es verändert sich dadurch nicht nur der Gegenstand, sondern auch ich mich selbst.» Aber ein weiterer, das ist das angenehme an dieser Debatte, springt ihm schließlich bei, indem er dem nächsten anderen, der gerne und durchaus nicht haltlos über Genüsse schreibt, verdeutlicht: «Wenn man nicht gelernt hat, Aromen zu unterscheiden, gibt es keine Genußfähigkeit bei guten Weinen und schottischen Single Malts.» (Alle hier.)
Diese Debatte ist so alt wie die im allgemeinen, auch von mir, geschätzte oder einfach nur gehörgängige alte Musik. Daß auch die einmal eine neue war, wird bei solchen verbalen Wasserglasstürmchen oft vergessen, gerne auch schon mal der Wahrheitsfindung geopfert. Als Mut zur Lücke wurde das im altschuligen Journalismus mal gelehrt, schließlich war nicht ewig Platz in der Zeitung oder im Programm. Im internetten Zeitalter der Grenzenlosigkeit scheint dieses einstmalige Hilfsmittel zur Textverknappung allerdings zur Devise der Niveauabsenkung mutiert zu sein. Ein Bild sagt mehr als tausend Wörter. Zurück zu den Zeiten der Bibel für Arme, als Worte noch bildlich dargestellt werden mußten.
Die mich anfänglich versorgenden Brustduftdrüsen haben mir zwar immer allerbeste Qualität, aber ausschließlich alte eingeflößt, teilweise bis zum Erbrechen. Als es später nachließ, das manchmal Kotzen genannte abwehrende Ausscheiden, gelang es mir, mich wieder diesem Genuß hinzugeben, der mir nunmal zunächst in die Gene, dann in den Magen und somit ins Blut und schließlich auch noch in die Sozialisation hineingefahren war. Aber ich hatte eben währenddessen auch andere Küchen kennenlernen dürfen. Einen weniger strengen Vater gab es nämlich, der mir glücklicherweise quasi klammheimlich und einfühlsam, also ohne die mütterlich-pädagogischen, recht einbahnigen Direktionen, von den Vorteilen auch der durcheinandrigen Vielfalt erzählt hatte; teilweise hatte er sie sogar am Kind selbst praktiziert. Dieses feine Wissen erleichterte es mir dann in freier Wildbahn ungemein, mich in fremden Küchen nicht nur nicht wie in der Fremde zu fühlen, sondern mich auch schon mal mittendrin ungezwungen der Völlerei hingeben zu dürfen. Wohl fühle ich mich dabei primär an den blankgeputzten Holztischen jener Ärmerenspeisung, bei der es keines zelebrierenden Sternleins bedarf, um Gutes zum leuchten zu bringen, also auch ohne jene sichtverstellenden, quasireligiöse Gemütlichkeit produzierenden Kandelaber, da ich gerne sehe, was an Köstlichkeiten in mich hineinsoll. Eine Kantine habe ich irgendwann auch gefunden. Jeden Tag köchelt da jemand anderer. Momentan rührt da gerade Judith Chaine Bartok, Khatchaturian und Stravinsky zusammen, im Théâtre du Châtelet.
Gut? Was ist eigentlich gut? Aus dem erwähnten Gerangle hat sich einer absentiert, der zu dem relativierenden Fazit kam: «[...] es ist ein Streit über Haltung und Geist, über Sozialisation, Normen und Denkmuster.» Ich höre zum Beispiel unter anderem sehr gerne Sibelius; der war irgendwie mit hineingeraten in den Kleinstkindcocktail. Heutzutage darf man den wieder hören wie man wieder Nietzsche lesen darf. Aber früher geriet man mit solch seltsamen Gelüsten rasch in eine No-Go-Area. Wegen meiner Sympathie gegenüber diesen Tondichtungen bin ich des öfteren belächelt worden. Nicht zuletzt von einem, der mich einmal eine ganze Nacht lang bei Schubert-Liedern davon zu überzeugen versuchte, daß italienische Rotweine besser seien als französische. Näher kamen wir uns bei einem Barolo, der fast so alt gewesen sein dürfte wie der Komponist dieser kunstvollen Lieder. Was er nicht wußte: Dieser Wein gehört zu denen, die ich geschmacklich durchaus zu den bevorzugten zähle. Vielleicht liegt es ja daran, daß im Piemont auch langue d'oc und auch Französisch gesprochen wird. Lachend in die ermatteten Arme gefallen sind wir uns dann mit Miles Davis' von Puritanern einst so gescholtenem (und über die Tube leider nicht mehr erreichbaren) Bitches Brew, diesem stellenweise tatsächlich fast noch ein wenig rock'n'rollenden späten Bebop, der mich auch heute noch direkt durchpulst und mir reinfährt wie früher diese vielen SevenAndSeven, die mich in dunklen Spelunken trunken — ach, in solchen coolen jazzigen Amikellern eben, die's überall gab, sogar in den USA.
Neue Musik. Etwa zwanzig Jahre habe ich gebraucht, bis ich annähernd begreifen durfte, was das meinen könnte. Sicher, ein bißchen John Cage und Philip Glass ging durchaus zuvor schon. Aber so richtig in mich hinein wollte sie einfach nicht. Bis ich mich eines Tages auf die Gespräche mit einem Komponisten dieser Musikrichtung einließ. Sachlich und fundiert erläuterte der mir dann seine Leidenschaft. Und eines Tages befand ich mich in einem Konzertsaal wieder, in dem Musik von ihm und anderen aufgeführt wurde. Am Ende des Konzerts fühlte ich mich sogar teilweise beglückt. Da war es mir ähnlich ergangen, als mich einige Zeit zuvor ein sogenanntes Erdferkel zur (s)einer Performance verführt hatte. Damals kam es zwar zu meinem bis heute anhaltenden Gehörschaden, aber ich hatte begriffen, was Punk ausmacht. Ich möchte dieses Erlebnis nicht aus meiner Erinnerung tilgen müssen.
Möglicherweise tat ich mich leichter als andere, da ich mich bereits in jüngeren Jahren mit dem Free-Jazz einer Musikrichtung zugewandt hatte, die auch schonmal als Krankheit bezeichnet wird. Sicher doch, Menschen, die breitbeining ganzarmig Klavier spielen, mögen taktlos sein. Aber meiner Gesundheit tat es zu diesem Zeitpunkt keinen Abbruch. Im Gegenteil, nicht nur über das Piano forte drang via Alexander von Schlippenbach einiges an Erkenntnis in mein Ohr und den anhängenden Kopf. Mit der Folge, auch die Töne des völlig desolaten Jazz Composer's Orchestra/ besser auseinanderhalten zu können.
Nicht täglich muß ich das haben. Aber ich hüpfe ja auch nicht jeden Tag mit dem Fahrrad über die Berge. Allzeit soviel Gesundheit würde mich krank machen. Auch lese ich nicht täglich Apollinaire, Baudelaire oder Lautréamont, obwohl ich die nun wirklich gerne mag. Lieblicher Eintopf aus der Auvergne schmeckt mir ebenfalls; es gibt erwiesenermaßen auch US-Amerikaner(innen), die köstlich sind. Den deftigen aus der Provence mochte die einwandernde florentinische Caterine de Medici überhaupt nicht. Weshalb Frankreich auch zu seiner heute so vielgerühmten Cuisine kam. Und ich vermag mich mittlerweile bei den Alten Meistern nicht nur Afrikas von den Neuerungen durch Pablo Ruiz und dessen Nachkreativen frohgestimmt lächelnd erholen.
Sogar der Kreischsäge meiner Kindheit höre ich mittlerweile (altersmilde?) wieder zu. Auch Bach lasse ich schonmal in mein Gehör hinein, obwohl es bei dem eigentlich ziemlich fremdelt. Ach, genaugenommen höre ich alles, bis auf Musical, Popularia, KlassikRadio, NDR-Kultur, was diese ganzen Antennensender für kommende bildungswillige Stände eben an Pralinchen so aufführen im schimmernden Schein der romantischen Schlaglichter. Aber ich bin es ja auch, der niemand ist und krank im Kopf.
«Da: wie er die roten Noten im vierten Takt ausspielt; die darin enthaltene Bewegung in den letzen beiden Roten auspendeln läßt und sicher austariert bis zur Oktave in der Linken, dafür könnte ich vor ihm auf die Füße fallen. Absatz bis zur ersten großen Steigerung.
— HÖLLISCH!»
| Do, 04.11.2010 | link | (4315) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ohrensausen |
Zur tiefblauen Nachtstunde
böte herbstliches Werben sich an, schrieb vor ein paar Jahren, als das Internet um diese Uhrzeit noch schlief, ein routinierter, mittlerweile bereits leicht auffällig gewordener Nachtradiohörer: Die dreiunddreißigjährige Moderatorin klärt den zweiundsiebzigjährigen nächtlichen lieben Studiogast über die vielfältigen pharmazeutischen Präparate gegen prostatabedingten Harndrang auf. Morgens gegen drei oder auch um zwei. Zwischen Häppchen von Pergolesis Stabat Mater oder dem gounodschen Ave Maria oder dem von Donizetti. Besonders Mütter (wobei nun nicht gerade an solche mit A-A-Problemen gedacht wird und auch nicht AAO [dazu das Bild der Grazer Künstlergruppe G.R.A.M aus dem Zyklus Wiener Blut]
 assoziiert werden soll) wissen ja bekanntlich am ehesten, was für die Gesundheit am besten ist. Auch ein kleiner Schnupperaufenthalt im Wellness Studio, das die Evangelian Church Foundation neuerdings in ihrem Augustinum Recreation Center installiert hat, zeigt neue Vitalitation auf, wenn der präsenile Bettflüchter kurz nach dem Aufstehen, so gegen halb drei oder noch früher, von diesen erotisch säkularisierten Betschwestern angepriesen wird, untermalt von Nigel Kennedys Violine, die aus Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten den immerwährenden Second Spring rüberspielt.
assoziiert werden soll) wissen ja bekanntlich am ehesten, was für die Gesundheit am besten ist. Auch ein kleiner Schnupperaufenthalt im Wellness Studio, das die Evangelian Church Foundation neuerdings in ihrem Augustinum Recreation Center installiert hat, zeigt neue Vitalitation auf, wenn der präsenile Bettflüchter kurz nach dem Aufstehen, so gegen halb drei oder noch früher, von diesen erotisch säkularisierten Betschwestern angepriesen wird, untermalt von Nigel Kennedys Violine, die aus Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten den immerwährenden Second Spring rüberspielt.Auch für Menschen des Statusses krankhafter Oblomowerei gäbe es sicherlich vorantreibende Angebote, die sich in Frau Lunas Lichte noch besser ausleuchten ließen. Aus den köstlichen Mündern dieser edlen Geschöpfe hörte es sich sicherlich ausnehmend klangvoll an, vermittelt zu bekommen, in welchem florentinischen Hotel man alle erdenklichen Vorläufer der französischen Cuisine an die Wiege serviert bekommt. Gut, sie müssen immerfort sagen, zum unerdenklich wievielten Mal: Es spielten James Galway und die Academy of St. Martin-in-the-Fields unter der Leitung von Sir Neville Marriner. Sie dürfen das solange sagen, bis eine andere Plattenfirma zahlt. Was spielt das für eine Rolle?! Hauptsache zur nachtstundenen Zeit flüstern sie unsereins zu, was einen in seinem Lieblingskaufhaus erwartet, wieviel Rabatt man einem via Clubkarte elektronisch bucht auf den Restposten des 89er Château Laroque, diesem wirklich ganz ordentlichen Grand Cru aus St. Emilion, der der Besucherin zumindest diese zutiefst fröhliche Melancholie mitgab, als sie sozusagen schließlich meinte, sich doch besser auf den Nachhauseweg zu begeben. Oder sie sollen uns ganz sanft in die Hörgeräte säuseln, wie hotelparadiesisch dieses oder jenes Weekend in La Bourboule mit seinen arsenhaltigen Quellen würde, quasi so, als ginge man zu ihnen nach Hause und kröche hinein zu ihnen ins Austernschaumbad.
Oder wenigstens, wo im Internet man den neuesten Rilke downloaden kann.
| Mo, 13.09.2010 | link | (4055) | 3 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ohrensausen |
Herbstgeflöte
«Lesen, lange Briefe schreiben»? Weshalb denn? Jede Fernsehanstalt zeigt bis zum erneut beginnenden Tag vierundzwanzig Stunden lang das pralle Leben — in Bildern. Ach du Gute Alte Zeit. Wir kehren — endlich — in sie zurück. Die Vorkommnisse der Weltgeschichte werden uns, da wir des Lesens — geschweige denn des Schreibens — nicht mehr mächtig sind, wieder über die Bilder mitgeteilt; wie bei der mittelalterlichen Armenbibel.
«Wachen», das schon. Es ist ein allerdings nicht das des sanften, melancholisch In-sich-Hineinhörens, es ist jenes, das die Berliner Freundin, die noch keinen Fuß auf den Pfad der Weisheit gesetzt hat, so despektierlich «senile Bettflucht» nennt. Nun gut: Wer nächtlich auf der Flucht vor sich selbst ist, kann sich immerhin sportlich betätigen. Surfen zum Beispiel. Im Internet. Das ist wie Fußballspielen auf der Couch, mit feingeschnetzelten Kartoffeln. Da ich jedoch kaum geeignet bin für Mannschaftssportarten, dauerlaufe ich mit Knopf im Ohr. Ich höre Radio.
Meine zu diesen Stunden auf Sanftheit und -mut programmierten Synapsen klöppeln mir dann solche Damen wie Frau Moll zurecht. Viele ihrer Art und zarten Weisen gibt es nicht im Äther. Sie hat eben nicht dieses nach verknacksten Knochen klingende T oder B der nach einem sich aus dem frühen Mittelalter in die Neuzeit geretteten fränkischen Kollegin der Frühnachrichten im Sprachduktus, der man deshalb zu Sprechunterricht geraten und die dann auch tatsächlich welchen genommen hat. Wobei sie an einen dieser immer mehr werdenden quer eingestiegenen ehemaligen Fischmarktpropagandisten und zum rasenden Börsenreporter auf- und nach einer Saison wieder abgestiegenen Lehrer geraten sein dürfte, der ihr dann in enormer Geschwindigkeit vermitteln konnte, daß der Begriff Kleinanleger seine Wurzel aus dem Kleingärtner zieht. Er konnte verständlicherweise ebenso nicht wissen, daß das g nach König ch zu sprechen ist, der Könich und die Könige. Bühnendeutsch wird das außerhalb Europas gern genannt. Nun ja, es tummeln sich schon ordentlich leicht fehlgesteuerte Adepten der einst geheimen Wissenschaften auf dem Mediengelände. Schließlich lassen sich nicht alle Berufsbezeichnungen schützen. Gleuropa wird's schon richten. Vom Tellerwäscher zum Senator.
Andererseits gibt's dann diejenigen, die ab sechs, also mitten im Tag und schrecklich wach, mir das Deutschradiohören verleiden und mich deshalb endlich ins Bett zwingen, weil sie sprechen, wie sie in gewissen Kreisen gerne gehört werden, Ann-Sophie oder Marc-Aurel, ein wenig wie von der Werbephotographie Erleuchtete — sozusagen ideal sprechend für Faltenröcke tragende, sich ständig über die Reeperbahn rettende oder über die Elbe ins Musical schwimmende lebenslange Töchter. Und die dann alle drei Minuten fröhlich ins Mikrophon rufen: Bleiben Sie dran! Sie sagen das so, wie ich früher gepfiffen habe, wenn ich in den Keller hinuntermußte. Nur hatte ich Angst, daß jemand da ist. Sie aber haben Angst, daß niemand da ist. Weshalb man auch dranbleiben soll. Schließlich kommen gleich die nächsten gut gelaunten Werbeklingeleien. Wie im Fernsehen.
Aber das eine ist ja das eine und das andere das andere. Die klassische Funkjournaille morgens ab sechs wägt der Welt Wichtigstes ab. Meine Moll-Damen aber wiegen und besummen den nächtlich Einsamen. Diese Stimmen werben nicht, sie umwerben. Nicht nur im werbefinanzierten Radio, auch im öffentlich-rechtlichen. Für den einen lohnt sich das nicht. Ihm zum Glück.
| So, 29.08.2010 | link | (3298) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ohrensausen |
Kurva
In dem Dörfchen kurz vor hinter Sibirien, wo sich mein nordisches Büro befindet, bin ich bekannt. Alles was abseitig ist oder nicht zugeordnet werden kann, landet in meinem Briefkasten. Der hat sein Volumen noch aus der Zeit, als ich noch ein Professioneller war. Die freundliche Postbotin ist recht froh darüber. Aus Dankbarkeit für die erleichternde Möglichkeit der Zustellung bringt sie ausnahmsweise mir zugedachte Sendungen wie Einladungen für warenterminliche Butterfahrten auch schon mehrere Male vorbei, wenn sie niemanden antrifft. Aber auch die Dorfbewohner selbst laden hin und wieder ab, was ihnen allzu fremd erscheint.
Möglicherweise wegen dieser vielleicht etwas andersgearteten oder auch -gemeinten, aber sicher ebenfalls liebenswürdigen Dreistigkeit habe ich sie wieder mal gehört, die Dame, die mir früher des öfteren das nächtliche Plauderdeckchen häkelte: die namens Moll, eine vom Pfarrer-Fliege-Dur heruntergefahrene Anne, die so erotisch klang. Da hatte mir doch tatsächlich jemand, dem meine Abartigkeit zugetragen worden sein muß, ahnungsvoll eine CD titels Die Wanderhure in den Briefkasten geworfen, mit einem Zettel dran, auf dem in zarter Jungmädchenschrift geschrieben stand: Vielleicht werden Sie sie mögen. Aber auf den Müll schmeißen können Sie sie immer noch. Dieser Hure Vermächtnis war vermutlich deshalb gleich mit beigefügt. Ich habe ja Frau Braggelmann in Verdacht, die eine ihrer zahlreichen Praktikantinnen als Botin mißbraucht haben könnte, um sich einen fröhlich lauthalsen Lacher zu verschaffen. Sie weiß nämlich genau, daß mir von diesen Historienschinken übel wird. Und dann auch noch vorgelesen. Aber deren Mutter, so hatte sie mir mal beiläufig berichtet, läse und höre alles aus dieser Zeit, als alles noch gut und nicht so schnellebig war.
Nun gut, gemütlich war es auch, als ich Frau Moll (hat hier in der Blogger-de-Gemeinde nicht jemand eine lieblich in die Jahre kommende Töle dieses Namens?) noch angstvoll bettflüchtend fortwährend lauschte. Es war meine Zeit mit den hintergrundbeschallenden Klassik Luna, mit First-class-music, diese Programme, die NDR-Kultur so erfolgreich nachgeahmt hat, auch Die Nacht der großen Meister. Das ganze Werk, aber eben nicht tagsüber, da ich noch keine Zeit hatte für ganze Sachen. Die moderierende Anne Moll hatte damals jenes Timbre in der Stimme, das der Bildschirmschoner benötigt, um sich nicht einzuschalten. So, wie die James Galway aussprach, diesem «André Rieu des Blasinstruments», wie ihn der Platoniker der Musik einmal nannte, mochte ich den nochmal so gerne abdrehen — und zu ihr ins Fruchtwasser kriechen. Und wie sie mit leicht rauchiger Rauhheit Ermanno Wolf Ferrari flüsterte, da hatte ich das Gefühl, die italienische Rollhilfe von Michael Schumacher würde in Maranello geklöppelt.
Nun hielt ich sie immer irgendwie für dunkelhaarig, wohl, weil mir das Dunkle näher steht oder auch liegt. Doch jetzt, da es das Internet gibt, erfahre ich, daß sie blond ist. Eine blonde Wanderhure des späten Mittelalters? Ich dachte immer, die wandernden Damen dieser Zeit kämen allesamt aus dem Süden oder, in ihrer Verruchtheit, zumindest aus dem Balkan, besser vielleicht noch aus Polen. Dort heißt es doch ständig kurva. Und nun stellt sie sich als eine Norddeutsche aus den ehemaligen Ostgebieten heraus. Meine Phantasie hat mich mal wieder in die Irre geführt.
Eine blonde Wanderhure höre ich mir nicht an. Andererseits wende ich mit meiner neuen, früher eben nicht erreichbaren Internet-Erkenntnis ein: Die unkühle Blonde lebt zwar in Hamburg, stammt aber aus Mecklenburg. Also treibt sie vermutlich slawisches Blut an. Ich sollte mir das vielleicht doch nochmal zur Prüfung vorlegen. Am Ende ergänzt sich mithilfe der Schinkenhistorie phantasievoll und in Moll mein dürftiges Bild von der Minne.
| Do, 26.08.2010 | link | (6617) | 18 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ohrensausen |
Flatrate-Hören
Immer wieder mal, wahrscheinlich, um mich selbst das Fürchten zu lehren, habe ich auf die frühen Versuche meiner Mutter und, wenn auch in Maßen, meines Vaters hingewiesen, aus mir einen Pianisten, zumindest einen passablen Klavierspieler zu machen. Die Problematik der frühkindlichen Einführung in die (Wunsch-)Welt der Erwachsenen ist so neu also nicht. Mit Tennis oder Skifahren konnte man früher noch nicht so recht Geld verdienen, und Holiday on Ice als Tanz auf dem Eis in die Zukunft kam irgendwie nicht so recht infrage. Selbstredend vermeldete ich jeweils den Abbruch der Versuchsanordnung meiner Madame Maman, aus mir einen anständigen Menschen zu machen. Auch habe ich selbstverständlich nie unterschlagen, wie sehr ich einige Jahre später diese mütterliche Resignation bedauern mußte, da ich meiner Verweigerungshaltung wegen nicht einmal den Flohwalzer, geschweige denn Für Elise geklimpert kriegte, als ich jungen Damen meine Liebe zur Musik beweisen wollte. Zurückzugelangen an meine grunderzieherischen Wurzeln, die in Bücher, dunkelblaue Pullover und Opéra am markantesten beschrieben sein dürften, war ein leichtes, zumal sich das teilweise ganz von selbst ergab. Aber mal eben locker in die Tasten hauen wie einige junge Männer in meiner Umgebung und unter der Anwesenheit des bereits genannten anderen Geschlchts — wenn ich das tat, dann kam allenfalls das heraus, was mit «Unstrukturiertheit» vermutlich am treffendsten zu beschreiben wäre. Wahrscheinlich ist das der Haupt- oder gar der wirkliche Grund für meine leidenschaftliche Hinwendung zur kleinen Freiheit.
Nun aber, beim längeren Nachdenken über Musik, hat die Langzeiterinnerung einmal mehr eines der erklärenden Phänomene zu mir selbst freigegeben, beispielsweise möglichst wenig von dem zu tun, das von mir erwartet wurde und wird. Und wieder ist meine Mutter die Ursache (ich scheine doch nicht loszukommen von ihr). Sie war bei einem Konzert gewesen, damals, als ich mich schon länger in der Geborgenheit eines Internats befand, aber noch nicht (aus-)reisen durfte; für sie hatte das die Dimension der wiedergewonnenen Freiheit, hin und wieder schauen zu können, wo mein Vater überall so hinschaute. Und auch ihrem Dienstherrn war das lieb, war ihre Arbeitskraft auf diese Weise doch besser zu nutzen.
Der schickte sie eines Tages, mein Vater mußte mit, weil er sich ungeschickterweise auf Stipvisite in seinem vorgeblichen Zuhause befand, zu einer damaligen Sensation. Entdeckt worden war sie 1958 in Moskau. Der zu dieser Zeit junge Mann spielte daraufhin überall auf, wo etwas zu holen war. War dies der Fall, konnte davon ausgegangen werden, daß ein omnipräsent-autokratischer Herr aktiv geworden war. Der hatte mal wieder was arrangiert irgendwo, wo genau, daran erinnere ich mich (noch) nicht, es könnte Berlin oder sonstwo ganz weit weg gewesen sein. Nach ihrer Rückkehr ließ meine Mutter nur noch eine Platte laufen. Es muß eine längere Ferienzeit gewesen sein, denn ich hatte keine Fluchtmöglichkeit etwa in die tiefen Wälder. So lautete meine Abwechslung vom gewohnten Opernterror fortan Nr. 1, b-moll, opus 23; nie werde die Bezeichnung dieses Werkes vergessen. Tag und Nacht lief das, wenn ihr etwas gefiel, dann war sie unerbittlich. Der junge Mann soll ja nach seinem großen Preis hin und wieder noch etwas anderes gespielt haben (bevor er sich etwas später, vermutlich des Immergleichen wegen, zunächst einmal zurückzog). Aber innerhalb unseres privaten Konzertsaals gab's nur eins: dieses Rosinchen vom großen Kuchen namens Tschaikowski. Wenn der erste Satz zuende war, wurde die Nadel neu aufgesetzt. Gnadenlos.
Der lieben Erinnerung wegen und Dank der Tube habe ich mir's jetzt wieder antun können. Etwas später hat er's in die Tasten gehauen, aber wieder in Moskau. Ich muß annehmen, daß damit der kalte Krieg eigentlich erst ausgerufen wurde. Erklärt haben könnte ich ihn. Ich kann's noch immer nicht hören. Fünfzig Jahre danach. Es geht mir wie mit dem Gin, mit dem ein paar fröhliche Menschen mich damals noch völlig vom Alkohol unberührten Neunzehnjährigen zwangsabgefüllt und auf einem Heuwagen hoch oben auf dem Dach eines Hauses abgelegt hatten (aber wer weiß, vielleicht habe ich ja ein bißchen mitgeholfen, denn von dieser vor allem ländlichen Tradition war mir während meines Besuchs in diesem Dorf berichtet worden).* Bis heute wird mir alleine vom Geruch dieses Destillats schlecht, und das, obwohl ich mich seither einige Male ordentlich durch die unterschiedlichsten Alkoholika geübt habe.
* Mein Beitrag zur aktuellen Diskussion, die Jugend tränke neuerdings vor allem wegen des Gruppenzwangs so viel Alkohol. Hier versorgen sich in erster Linie diejenigen mit Stoff, die ihn nötig haben (noch solch eine Kakophonie, die ich nicht mehr hören kann): des Volkes Stimme, die Medien. Aber das ist möglicherweise ein anderes Thema.
| Fr, 20.11.2009 | link | (5720) | 21 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ohrensausen |
Jean Stubenzweig motzt hier seit 6487 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00
... Aktuelle Seite
... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)
... Themen
... Impressum
... täglich
... Das Wetter
... Blogger.de
... Spenden
Zum Kommentieren bitte anmelden.
Suche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
AnderenortsSuche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
Andere Worte
Anderswo
Beobachtung
Cinèmatographisches + und TV
Fundsachen und Liebhaberstücke
Kunst kommt von Kunst
La Musica
Regales Leben
Das Ende
© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig
