Syn- und asynchron
Der Unerträglichkeit der Länge geschuldet. Vielleicht aber auch, weil es ein Thema leicht neben meinem ursächlichen Beitrag ist: Ergänzung und Antwort zu den Einlassungen der Herren Nnier und Terra40.
Behaupten könnte ich jetzt, mich ginge das alles nichts an, da ich ohnehin nur seltsame und geschwätzige französische Spielfilme anschaue. Erleichternd oder erschwerend, je nach Sichtweise, wirkt sich aus, daß Neuerscheinungen, seit ich mit Journalismus nichts mehr zu tun habe, der mich in die Pflicht genommen hatte, an mir abprallen. Und ins Kino gehe ich seit Jahren nicht mehr, da mein bereits lädiertes Gehör die irrsinnige Lautstärke in den Kinos nicht erträgt, die dort mittlerweile Normalpegel sind. Aber es geschieht auch im Fernsehen höchst selten, daß ich mir Spielfilme anschaue. Ich bin ein Freund der (unten erwähnten) Dokumentation, gerne des Theaters und der Oper, nirgendwo kann ich meine schöne, verehrte und innig geliebte Sopranistin(nen) so tief ergründen, manchmal reicht mein sehnsuchtsvoller musikalischer Blick bis zur, sag' ich mal, letzten, auf dem Magen liegenden Zahnarztrechnung. Bevor ich mir einen schlimme US-Streifen nachempfundenen Tatort anschaue, schaue ich mir lieber einen Film über «Yakmist in der Energiewirtschaft der inneren Mongolei» an. Und wenn dann doch tatsächlich mal englischsprachiges Kintop als wirklich empfehlenswert über drei Empfehlungsecken bei mir angekommen ist, dann lege ich es mir meist als DVD zu. Dann kann ich mir eventuell die jeweilige Sprache aussuchen. — Ach, ich fröne schon wieder dem Abschweiflertum ...
Zurück: Ich bin ohnehin der Meinung von Nnier zugeneigt. Und unterstreiche das vom Kulturimperialismus gleich dick und fett mit. Wann wird denn an US-Spielfilmen wirklich mal lohnenswertes gesendet? In der Regel sind das doch die Werke, deren Botschaft besonders der Deutsche sich zu unterwerfen allzu bereit ist. Die wenigen aus den USA, die mich interessieren, sind sprachlich häufig derart diffizil, daß der aktive Wortschatz meines dem Alltag zugewandten Englisch dazu oftmals nicht ausreicht. Ich erinnere mich an die Begeisterung, mit der ein seinerzeit mit mir annähernd befreundeter Mediziner mit nordamerikanischer Krankenhauserfahrung von den opulenten originalsprachlichen Dialogen der Koreakriegs-Chirurgen in MASH friwohlig berichtete. Ich habe mir den Film deshalb extra dreimal in der US-englischen Version angeschaut. Erkannt habe ich die gepriesenen sprachwitzigen Feinheiten dennoch nicht. Deshalb bin ich dann froh, wenn Spielfilme (gut) synchronisiert* sind.
Womit wir beim Problem wären. Der größte Teil dieser Sychronisationen ist meist ohnehin derart runtergenudelt — und häufig sprachlich auf Breitenwirkung hin angelegt —, daß es auch schon keine Rolle mehr spielt. Auf mehr Qualität müßte geachtet werden. Das geht, aber es kostet Geld. Und das auszugeben sind Produzenten, oft genug mit Verleihern verbandelt, längst nicht mehr bereit. Es würde unter Umständen die Einspielergebnisse von dreistelligen Millionen US-Dollar gefährden. Da es den meisten Zuschauern ohnehin wurscht zu sein scheint, allemale unterhalb von A-Produktionen, wird das quasi analogisch im Schnellverfahren abgewickelt. Fast Food eben. Was Sorgfalt leisten kann in der Synchronisation — von Nniers Hinweisen mal abgesehen — belegte vor ein paar Jahren Cyrano de Bergerac (hier teilweise thematisert). Von da an ließe ich mit mir reden, was die Qualität von Synchronisation betrifft. Sicherlich gibt es weitere Beispiele, auch unter englischsprachigen Spielfilmen. Aber mir sind keine bekannt. Was selbstredend auch meinem mangelnden Interesse geschuldet ist.
Wollen Sie tatsächlich alles untertitelt haben, wie das bei Ihnen in den Niederlanden, aber auch in anderen Ländern üblich ist? Ich bekomme bereits in den von mir bevorzugten Dokumentationen Zustände, wenn ich lesen muß, was da angeblich gesagt wurde. Das alleine ist — auch aus der Weltarbeitssprache Englisch «übersetzt» — teilweise bereits filmerweichend falsch. Oft genug fällt mir dabei das abgegriffene Praktikant ein. Denen will ich das gar nicht mal vorwerfen, da es ihnen meistens an Wissen und Erfahrung mangelt. Da wird seitens der Produzenten unsäglich geschludert. Kostenreduktion nennt man das wohl, neudeutsch gerne sparen genannt. Und was macht der Zuschauer bzw. -hörer eines aserbeidschanischen, finnischen, oder, en vogue mit zunehmender Tendenz, chinesischen Spielfilms? Wer untertitelt da? Diejenigen, die auch die Gebrauchsanweisungen oder die Reiseprospekte übersetzen? Die reizende Studentin etwa der Germanistik im zweiten Semester, die vom Padre Patrone des Medienkonzerns in den koproduzierenden Sender hineinbugsiert wurde? Mittlerweile verstehen immer mehr junge Menschen nicht einmal mehr die Sprache des Landes, in dem sie aufgewachsen sind und dessen Nationalität sie oft auch besitzen; Frankreich wäre da wohl nur ein Beispiel. Die umseitig erwähnte Fernsehanstalt TV 5 Monde der francophonen Gemeinschaft untertitelt auch. Aber in Französisch. Unter anderem deshalb, damit die zuschauenden Hörer überhaupt mitkriegen, was die in den Spielfilmen da quasseln. In der Landessprache, wohlgemerkt.
Was sie als «Filme mit künstlerischen Ansprüchen» bezeichnen — davon mal abgesehen, daß das eigentlich jedem Film innewohnen sollte —, also gut, «Kunstfilme», die «auch in den dritten Programmen der deutschen Fernsehsender im Originalton und untertitelt gesendet werden», womit gemeint sein dürfte, daß sie sich vom normalen Programm durch besondere Intentionen und Produktionsweisen abheben, die richten sich bereits an eine Minderheit. Von der kann unter Umständen bereits von einer Mehr-, zumindest aber Zweisprachigkeit ausgegangen werden, die dieses Metier erforderlich macht. Menschen, die sich solche Filme gezielt anschauen, bewegen sich in der Regel auf internationalem Parkett, wenigstens geistig. Die englische Sprache dürfte Bestandteil dessen sein. Beim innermongolischen Dialekt wird's dann schon schwieriger.
Ich hatte einmal das Vergnügen, mit einer Künstlergruppe aus diesem Sprachraum zu tun zu haben. Verstanden haben wir uns prächtig. Am besten verständigt man sich mit Menschen in einer Sprache, die niemand richtig beherrscht, vollends fröhlich wird's dann, wenn der Wodka als Übersetzer tätig wird. Diese Künstlergruppe stellte unter anderem Filme über ihre Arbeit her. Selbstverständlich in ihrer Sprache, versehen mit ein paar selbstgebastelten englischen Untertiteln. Wie auch anders? Gerne hätte sie wenigstens einen richtigen Kommentar dazu gehabt. Das aber hätte, zumindest für die Produktion im obendrein weit entfernten Studio, viel Geld erfordert. Das sie nicht hatten.
Und aus dieser Perspektive sollte unter anderem die Tatsache betrachtet werden, daß auch viele Spielfilme, von wem auch immer untertitelt, gesendet werden. Sie werden meistens bereits sehr preisgünstig für die Mitternachtsschiene der vom normalen Alltag übriggebliebenen null komma neun Prozent Zuschaueranteil eingekauft. Vermutlich keine Fernsehanstalt wäre bereit, die doch recht aufwendige sprachliche Adaption für einen Streifen zu bezahlen, der nach der Ausstrahlung für immer ins All entschwindet. Nicht einmal für englischsprachige Produktionen. Da sei Götze Sport vor. Zum Beispiel. Was nicht heißen soll, daß alle in Originalssprache gesendeten Spielfilme diesem Gesetz unterliegen. Selbstverständlich liegen hier Bedarf und Notwendigkeit vor. Aber einige dürften durchaus darunterfallen.
* Gestatten Sie mir eine kleine Anmerkung: Nachsynchronisieren bedeutet, wenn Filme, meist bei schlechter Tonqualität, beispielsweise bei Außenaufnahmen oder anderen Gegebenheiten, von den Darstellern selbst im Studio in der Sprache des Films nachgesprochen werden. So ähnlich jedenfalls. Das komplette Übertragen in eine andere Sprache wird im Deutschen schlicht Synchronisieren genannt.
| Di, 09.02.2010 | link | (2671) | 10 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |
Programmplatz eins
Menschen gibt es, die behaupten, arte habe für viele lediglich eine Alibifunktion. Da mag durchaus was dran sein. Aber mit mir ist bei dieser grundsätzlichen, meines Erachtens ohnehin häufig vorgeschobenen Fernsehablehnung keine Statistik zu gestalten. Es gibt ohne Zweifel Hervorragendes zu sehen, wobei ich die Privaten vermeide, nicht nur wegen der Werbung, sondern auch des anderen nicht nur Restmülls wegen. Und ich gehöre zu den regelmäßigen Guckern des deutsch-französischen Kanals, sowohl im Süden als auch im Norden, seit es den Sender gibt. Zerwürfnisse bleiben da nicht aus. Was sich liebt, das brüllt sich sich auch schonmal an. Wenn ich mich an Großartigkeiten erinnere, in die ich auch schonmal zufällig gerate, hängt es meistens mit arte zusammen. Es mag am Programmplatz eins liegen.
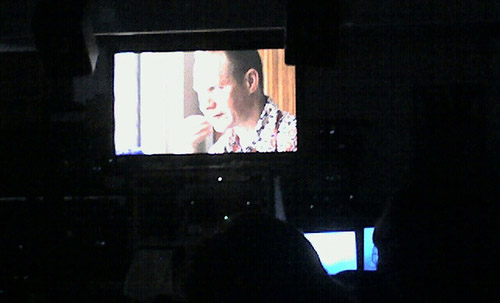
Einmal mehr war das der Fall. Dem Büro in mein Morgenschläfchen entwichen und danach unversehens ins Programm geraten, aber offensichtlich doch kurz nach Beginn, hielt ich ihn, vom Bild her wohl das zweite mal nun schon, für Nigel Kennedy, vermutlich wegen seiner steilen Haare. Dann wunderte ich mich jedoch über sein flammendes Plädoyer für das Theater. Ob er wohl aus Altersgründen die Violine beiseite gelegt und ans Regiepult und auch gleich noch in den Hörsaal getreten sein könnte, fragte ich mich, immer noch leicht verschlafen, und deshalb ein solches Engagement an den Tag legte, wie das nur jemand kann, dem sich gerade eine neue Welt aufgetan hatte. Sein seltsam tippeliger Gang hob die Verwechslung dann allerdings auf, denn den kannte ich, habe ich mich vor längerer Zeit doch schon einmal über ihn gewundert, vor langer Zeit bei Kaija Saariahoo, bei den Proben zur Salzburger Uraufführung ihrer Oper L'amour de loin, inszeniert von dem US-Amerikaner, dem vermutlich letzten Weltbürger alten Schlages, gleichwohl immer noch jünger an Jahren. Als er noch Kind war, verspürte seine kein Wort Französisch sprechende Mutter das Bedürfnis, überzusiedeln nach Paris, wo er dann offensichtlich alles in sich aufsog, was annähernd mit den Künsten zu tun hat. An ihrem Gang soll man sie erkennen. Der ist allerdings so unverwechselbar wie seine Kunst. Die war mir zwar nicht neu, aber seine Äußerungen, die in Ausschnitten erläuternden Oper- und Theaterszenen trugen doch erheblich zum tieferen Eintauchen bei. Ähnlich ging es mir seinerzeit bei der Dokumentation über Jessye Norman.
Es dürfte nunmal kaum jemandem beschieden sein, zwei Jahre lang ein solches Musik-Theater-Phänomen begleiten zu dürfen wie hier Mark Kidel. Ich gehe davon aus, daß der, vielleicht nicht ganz so anhaltend wie die Begleitphase selbst, aber doch sicher einige Monate an Sichtung, Auswertung der Gespräche sowie des fremden Filmmaterials gesessen haben dürfte, vom Schnitt mal abgesehen. Eine solche Arbeit führt dann zu einer Dichte, die vermutlich Sellars in sich selbst erst einmal zusammensuchen müßte. Es sind die Gespräche mit Komponisten, Kritikern, Sängern und Schauspielern, in jeweilige Inszenierungen eingebundene bildende Künstler als Bühnenbildner, Intendanten und Freunde, die teilweise überwältigenden Nahaufnahmen, beispielsweise von der mich immer wieder faszinierenden Dawn Upshaw, die Lust auf immer mehr machen. Aber mit einem Mal ist der Film dann zuende, dessen Konzentration aufs wesentliche lediglich von wenigen Einsprengseln des Stargehopses, ach, nicht einmal gestört wird, da das als Bestandteil eines solchen Lebens nunmal ebenfalls kurz gezeigt werden muß. Dann kommt jene Trauer auf, wie sie vom petit mort bekannt ist, dem wunderschönen kleinen Tod, dem Liebeszenit, der nicht nur den Höhepunkt beschreibt, sondern auch die Trennung.
Wer sollte das eher bieten als der Film im Fernsehen? Ins Kino dürften sich solch filigrane Dokumentationen wohl kaum verirren. Und für die DVD benötigt man nunmal auch so ein Gerät (im Computer möchte ich so etwas nicht anschauen) — wenn sie denn überhaupt auf den Markt gerät oder gar, was ja häufig genug geschieht und das Ganze noch etwas ärgerlicher macht, nach kurzer Zeit wieder von ihm verschwindet, weil sich's nicht rechnet.
| Mo, 08.02.2010 | link | (3038) | 10 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ich schau TeVau |
Justitia als Randerscheinung

Ich beabsichtige auch in Zukunft nicht, mich zum aktuellen politischen Geschehen zu äußern. Aber die Debatte der letzten Tage beschäftigt mich zu sehr, vor allem, weil sich mir ein geradezu ungläubiges Kopfschütteln eingeprägt hat, ein Gesicht, in das ich fast ein wenig Verzweiflung hineininterpretieren möchte ob der Vorhaltungen gegen den, zu dem es gehört: Gerhart Baum. Er ist Gegner des Kaufs der widerrechtlich angeeigneten Daten aus schweizerischen Banken durch die deutsche Bundesregierung. Mich empört das nicht, weil ich Angst um ein in der Schweiz steuerrechtlich illegal angelegtes Vermögen hätte. Es verbittert mich, daß diesem Mann (sowie anderen) vorgeworfen wird, was den meisten offensichtlich abhanden gekommen ist: Rechtsempfinden. Vom Argument des Vergehens gegen den Datenschutz mal abgesehen, um den er sich nun wahrlich verdient gemacht hat, auch ich bin der Meinung, daß derjenige sich schuldig macht, der geklautes Material kauft. Der ehemalige Bundesinnenminister und als Rechtsanwalt tätige Baum weist vor allem darauf hin, daß dies Folgeentwicklungen zeitigen könnte, die irreparabel sind. Wie soll in Zukunft noch wirkungsvoll für den Schutz von Daten gestritten werden, wenn jedes pickelige Ganovenpfeifchen in seiner kleinen, ihm anvertrauten Dienststelle einfach ein bißchen was oder noch etwas mehr auf eine CD kopieren und für sattes Geld verhökern darf — und das auch noch an höchste Stellen? Es muß andere Möglichkeiten geben, an Steuerhinterzieher heranzukommen. Wer sich aus dem Staub machen will mit seinem Geld, dem wird es ohnehin gelingen. Und es wird sie geben, denn auch die schweizerischen Banken werden nicht umhin kommen, den Rest des insularen Status' ihres Ländchens dranzugeben, will es nicht vollends erdrückt werden. So, wie es hier gehandhabt wird, entstehen nur trotzige, geradezu kindische und lächerliche, köppelartige Reaktionen, für die auch noch aus einer Ecke heraus applaudiert wird, aus der heraus der olle Willem Tell für einen unangreifbaren Götzen gehalten wird, und mag er noch so Legende sein.
Ist eigentlich alle Besonnenheit dahin? Oder gilt Rechtsempfinden mittlerweile als leicht romantizistische Randerscheinung? Dann darf man sich nicht weiter wundern.
Nachtrag: Soeben lese ich via Kritik und Kunst im Lawblog — das war an mir vorbeigegangen — «Das Bundesverfassungsgericht hat in einer heute veröffentlichten Entscheidung ausdrücklich festgestellt, dass Beweise verwertet werden dürfen, auch wenn sie auf rechtswidrige Weise gewonnen wurden.» An meinem Rechtsverständnis ändert das nichts. Wenn ich an die Berichte des Parlamentarischen Rats zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland denke, in die ich mich in den Siebzigern einmal vertieft hatte, wird mir ohnehin ganz anders, was aus alldem geworden ist ...
| Fr, 05.02.2010 | link | (5809) | 19 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |
|
|
Jean Stubenzweig motzt hier seit 6391 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00
... Aktuelle Seite
... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)
... Themen
... Impressum
... täglich
... Das Wetter
... Blogger.de
... Spenden
Zum Kommentieren bitte anmelden.
Suche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
AnderenortsSuche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
Andere Worte
Anderswo
Beobachtung
Cinèmatographisches + und TV
Fundsachen und Liebhaberstücke
Kunst kommt von Kunst
La Musica
Regales Leben
Das Ende
© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig
