Heimat, ein Los
Der eigentümologisch kluge Kluge beschreibt sie wie folgt:
‹heimoti›, ‹heimuoti› mittelhochd. ‹heimot› (got.), nur die im zweiten Glied abweichende Zusammensetzung ‹haimothi› für Grundbesitz, die in ahd. ‹heimodil›, oberösterreich ‹hoamatl›, für Gut oder Anwesen wiederkehrt mit derselben Endung wie Armut und Einöde zu germanisch ‹haima› für Heim.
Ein anderer beklagt sein Los auf diese sanfte Weise.
Es dürfte wohl Christian Morgenstern gewesen sein, bei dem ich vor Jahrzehnten gelesen habe: Heimat sei überall dort, wo man Freunde finde. Heimat. Wie oft in meinem mittlerweile nun doch bereits eine Weile andauernden Leben, auf dessen Ende ich mich seit einigen Monaten vorbereite, meinte ich, angekommen zu sein. Doch immer wieder aufs neue mußte ich feststellen: es gibt keine Endstation. Jedenfalls keine im Leben.
Seit ich erste eigene Gedanken entwickelt habe, möglicherweise gar bereits innerhalb meiner präintellektuellen Phase, in der mir Botenstoffe des Denkartigen oder -würdigen noch über die mütterlichen Brustduftdrüsen in die Synapsen injiziert wurden, befand ich mich auf der Suche nach der Bedeutung des erst später erfahrenen Begriffs, der sogar in anderen Sprachen als der deutschen scheinbar heimatlos herumirrt; von der gleichen Fremdheit wie etwa Kindergarten oder Waldsterben. Heimat. Es mag an meiner später erfolgten, eigentlichen Sozialisation liegen, die innerhalb deutschsprachiger Regionen stattgefunden hat, wo Heimat alles andere als ein Fremdwort ist. Beispielhaft wären die Ost- und sicherlich auch die Nordfriesen zu nennen, die derart von ihrer Heimat beseelt sind, daß sie zu nahezu jedem Wochenende von ihrem Arbeitsplatz im tiefsten Süden Deutschlands die rund tausend Kilometer bis an die Wasserkante klaglos bewältigen. Auch die jeweils bevorstehende sonntägliche Rückreise auf der völlig überfüllten Autobahn hält sie davon nicht ab. Und ein Wendländer berichtete mir, er käme erst gar nicht auf die Idee, die Grenzen seiner Gemarkung zu überschreiten. DAN, das Kraftfahrzeugkennzeichen für Lüchow-Dannenberg, gehört folglich zu den Raritäten auf den Straßen außerhalb Nord-Niedersachsens.
Nach einer Heimat habe ich mich immerzu gesehnt, wo auch immer ich mich aufhielt. Es ging mir wie dem Kleinkind, das sich nach nichts anderem sehnt, als nach dem immergleichen Blick aus dem Bettchen auf die Decke, der sich nach dem Öffnen der Äuglein ergibt. Ein weiser Pädagoge hat diese meine Sehnsucht, die ich als etwa Dreißigjähriger ihm gegenüber einmal erwähnte, da ich mich sicher wähnte, er würde mich dieser seltsamen Anwandlungen wegen nicht spöttisch belächeln, einmal psychologisch bestätigt. Es sei für die positive Entwicklung eines Kindes von elementarer Bedeutung, ihm bis etwa zum Alter von drei Jahren eine gewohnte Umgebung zu bieten, angefangen beim feinen und mit Heu ausgepolsterten Weidekörbchen, in das man einst einen Religionsgründer bettete, bis hin zum ersten Gefängnis namens Laufstall, auf daß der erste Horizont sich nicht allzu ausschweifig gestalte. Dieses Gespräch fand allerdings in den Siebzigern statt, also weit vor der Zeit, in der ich als nunmehr fast Siebziger immer noch auf der Suche bin nach der Perspektive aus dem Bettchen nach oben zum Himmel mit funkelnden Sternchen aus Staniolpapier.
Bereits als Allerkleinster wurde ich in der Weltgeschichte herumgekarrt. Ein leichtes wäre es, diesen Wandertrieb meiner Eltern damit zu erklären, es hätte ihnen im Blut gelegen. Es existiert schließlich die nicht nur theologisch begründete Behauptung, die jahrhundertelang andauerende Vertreibung aus aller Herren Länder habe sich historisch bedingt genetisch niedergeschlagen. Ich vermute allerdings, es könnte ein anderer Fluchtreflex gewesen sein, der Flucht vor sich selbst.
Bei mir begann es zu einer Zeit, als andere aus Leningrad in Richtung Westen flüchteten, während meine Eltern freiwillig gen Osten aufbrachen. (Der freundliche Enzoo hat diesem historischen Akt einmal ein Denkmal gesetzt, das zugleich meine darauffolgende Übersiedlung in die Gemarkung finnischer Cowboys würdigt.) Möglicherweise lag der Drang in die östliche Richtung nahe, da es meinen Vater nach Heimat sehnte; sie lag jenseits des Ural. Und zu diesen Zeiten gehörte es nunmal zu den gesellschaftlichen Gepflogenheiten, daß eine Frau dem Gatten zu folgen hatte, und stamme sie auch noch so weit westlich ab, wie das bei meiner Mutter der Fall war.

Der Leningrad-Cowboy wurde im Anschluß an den Aufenthalt in der Stadt, die seinerzeit noch nicht wieder in Heilig Petersburg zurückumbenannt worden war, zunächst in den Westen gerollt, in die Region, wo kurze Zeit zuvor im finnisch-russischen Winterkrieg noch Töter agierten. Suomi sollte mein erster Versuch der Heimatfindung sein. Im Gepäck meiner Eltern zog ich zwar zwischendurch immer wieder in andere Länder, in andere Erdteile, aber nach Finnland kehrten wir immer wieder zurück. Irgendwann nämlich verweigerte sich meine ohnehin eher bodenständig veranlagte Mutter dem Nomadenleben. Dazu beigetragen haben dürfte ihre solide Ausbildung als akademische Bibliothekarin, die ihr eine Anstellung in einer renommierten Stiftung einbrachte. Es ließe sich als der Beginn einer Emanzipation bezeichnen, die dazu führte, meinen Vater aufzufordern, gefälligst alleine weiterzuwandern in Gegenden, in denen es durchweg nicht anderes zu tun gab, als Gesteine zu erforschen. Ich wurde in ein Internat abgeschoben, was mir insofern durchaus zupaß kam, erhoffte ich mir auf diese Weise so etwas ähnliches wie ein tatsächliches Zuhause. Dort erlernte ich erste Ansätze gemeinschaftlichen Lebens, unter anderem beim Eishockeyspiel, in dem der rüde Umgang mit dem Gegner regelkonform ist. Das Spiel blieb mir erhalten auch nach meiner Übersiedelung nach Berlin, wo ich fortan Preußen verteidigte. Doch wann immer das blaue Kreuz auf weißem Grund, siniristilippu, etwa anläßlich einer Sportübertragung, im Fernsehen wehte, ich gehörte zu denen, die selbst beim Fußball, einer im sogenannten Land der tausend Seen eher unterentwickelten Spielart, mich als flammender Nationalist erwies und in der Charlottenburger Kneipe laut S-u-o-m-i skandierte; der Begriff Imigrationshintergrund sollte erst sehr viel später aus Gründen politischer Korrektheit kreiert werden.
Dieses Heimat-Fanalische hielt sich bis zu meiner Übersiedlung in den Süden Deutschlands, in die Marktgemeinde, die Ödön von Horvath mit seiner Italienischen Nacht eindruckvoll charakterisierte und die zu dieser Zeit durchaus als postnationale oder auch präsozialistische Nachwehen erkennbar waren. Ich fühlte mich wohl in diesem Städtchen, zumal mir freundliche Menschen eine Behausung boten, die mir überdies einen freien Blick über das Murnauer Moos bot, das in meiner Phantasie über die Gemälde des Blauen Reiters festgemacht hatte. Es war also unter anderem die Kunst, die Malerei, die mir über diesen voralplerischen Landstrich ein Stück Heimat bot.
Daß ich Finnland, die Mentalität dieser Menschen und deren Kultur erst sehr viel später, als ich schon gar nicht mehr sehnsuchtsvoll dorthinreiste, kennenlernen sollte, muß damit zu tun haben, daß ich mich darin verwurzelt fühlte. Aki Kaurismäki oder Mauri Antero Numminen, mit dem mich via Laubacher Feuilleton eine Zeitlang eine reizvolle Korrespondenz verband, haben entscheidend zur Festigung dieser Verbundenheit beigetragen. Allerdings kann ich heute nicht mehr behaupten, es seien Heimatgefühle. Sie sind ausgeschieden, ich muß weitersuchen.
Häufig kommt es neben der der Frage nach dem beruflichen Werdegang (Was mach'sten du so?) auch zu der unvermeidlichen nach der Herkunft. Gestellt wurde sie, obwohl ich offensichtlich über keinen Imigrationshintergrund verfüge, zudem leicht erkennbar der kaukasischen Rasse zuzuordnen bin, in der Regel von Menschen, denen ich in Küchen begegnete, in denen während der Parties der Nudelsalat bevorzugt eingenommen wurde. Das Witzchen, ich sei in einem Hotel beim Bettenmachen gefunden worden, zündete bei einigen nicht so recht, und auch mein Hinweis auf Moses in seinem Körbchen auf dem großen Nil fand nicht unbedingt Anerkennung als seriöse Auskunft. Immer wieder mal sah ich mich genötigt, Mutterländisches zum besten zu geben. Die häufigste Reaktion lautete und lautet noch heute, es müsse doch etwas Wunderbares, ja –schönes, etwas Großartiges sein, bereits in jüngsten Jahren in der Welt herumgekommen zu sein. Mein oftmals erfolgter Hinweis auf eventuelle andere Sichtweisen rief in den meisten Fällen zumindest den Ansatz von Erstaunen hervor. Zustimmung für meine Heimatsuchperspktive fand ich durchweg erst dann, wenn ich mein Leid klagte, über solch bezaubernde Erlebnisse wie etwa ein Sandkasten-, Kindergarten- oder Klassentreffen nicht zu verfügen, da immer dann, wenn sich meinerseits zarte freundschaftliche Bande zu entwickeln begannen, meine Eltern gerade wieder Kisten und Koffer packten; Freundschaften, so hatte meine Mutter mich in meinen spätjugendlichen Jahren, kurz vor unserer Scheidung, belehrt, stellten ohnehin nichts als Stolpersteine dar auf eigenen Wegen zu Zielen des Lebens.
Vor einiger Zeit habe ich mich also mal wieder aufgemacht. Mein Drang zur Flucht (vor mir selbst?) hatte mich mal wieder erschüttert. Alles habe ich liegen und stehen lassen, mich in Zielrichtung einer Endstation begeben, da mir jedwede Perspektive abhanden gekommen ist. Doch ich mußte festellen: Es gibt keine Endstation, zumindest keine namens Heimat.
Von jungen Jahren an war ich immer wieder einmal kurzzeitig vom Glück beseelt, angekommen zu sein. Wo auch immer ich Station machte, es war jedoch nie von Dauer. Einst war es der Blick übers Murnauer Moos, den mich der Blaue Reiter gelehrt hatte. Dorthin zog es mich. Ich hatte das Glück — andere mögen es als Schicksal bezeichnen — , auf freundliche Menschen zu treffen, die mir genau an diesem temporären Sehnsuchtsort, den ich durchaus mit der Suche nach einer Erklärung für die Kunst, hier der Malerei, verband, eine optische Horizonterweiterung in Form eines Zuhauses zu bieten, von dem ich sicher war, es sei ein endgültiges. Ein Jahr später war ich bereits in die große Stadt im Norden des oberbayerischen Südens geflohen. Als in der Großstadt Geborener und in Metropolen Aufgewachsener hielt ich die Enge der seinerzeit noch immer stark von der Enggeistigkeit der beschaulichen Marktgemeinde, die Ödön von Horvath in seiner Italienischen Nacht, nenne ich’s mal so, trefflich beschrieben hat, nicht mehr aus. Es erfolgte die Vertreibung aus dem Paradies. Dann landete im sogenannten größten Dorf der Welt. Eine Offenbarung möglicher Heimat war es nicht. Vom ersten Tag an befand ich mich auf der Flucht. Immer wollte ich hinaus aus diesem Ort, den der vor Jahrzehnten von der münchnerischen Süddeutschen Zeitung zum in Hamburg ansässigen Spiegel geflohenen Claudius Seidl als «unsere kleine Stadt» bespöttelt hatte. Fast dreißig Jahre ging das so. In den Anfängen hatte ich zwar hin und wieder das Gefühl, in eine Art Heimat einzureisen, etwa dann, wenn ich in der Bahn die Weinhügel Frankens durchquerte. Diese leichten Anflüge von Heimat-Euphorie hielten nicht lange an. Schließlich beschloß ich, es habe keine Frage des Ortes zu sein, wo man beheimatet sei.
Gegen Ende der neunziger Jahre brach mein System zusammen, das die Medizin der Hirnforschung zuschreibt. Der chefärztliche Neurologe einer Unversitätsklinik diagnostizierte einen Dachschaden, zwar genetisch bedingt, aber eben doch erheblich. Der war meiner Heimatforschung allerdings durchaus zuträglich. Ein Kinofilm spülte mich an einen Ort, von dem ich sicher war, bei ihm allein könne es sich um die Endstation meiner Sehnsüchte handeln. Und wieder handelte es sich um eine Stätte, an der die Malerei ihre Spuren hinterlassen hatte. Doch sie ergab sich als ein Nebenprodukt. Mich interessierte nicht so sehr, daß ein Braque oder ein Picasso und noch einige Artisten dieser Art mehr dort ihre Malspuren hinterlassen hatten, sondern die Charakteristik einer Gemeinschaft hatte mich angezogen, die mir über dieses stille filmische Meisterwerk vermittelt wurde. Es hatte mich nach l’Éstaque getrieben. Bei dieser Gelegenheit erinnerte ich mich meiner Herkunft, zumindest mütterlicherseits, die andere als eigentliche Heimat bezeichnen. Überdies gilt die Mär, einen jeden zöge es ans Mittelmeer; Joseph Roth behauptete gar: «Jeder trägt seine Heimat an der Sohle und führt an seinem Fuß die Heimat nach Marseille.» Dort saß ich dann, immer in einem der beiden Cafés, die im Land auch als BarTabac bekannt sind, um den Quai des Belges herum und schaute auf den Alten Hafen. Fortan war ich beheimatet.
Von dort aus korrespondierte ich angeregt mit einer Frau. Frauen spielten in diesem Abschnitt meines Lebens, der extrem von einer vorübergehenden Amnesie gekennzeichnet war, verursacht durch meinen Dachschaden, die beziehungsweise der partiell bis heute anhalten, eigentlich nur noch eine Nebenrolle; sie fand ihren ausgeprägtesten Ausdruck in der immerwährenden Anschaung dieser seltsamen Gattung der Menschheit. Doch diese Dame trieb mich in den Norden. Allerdings nicht etwa in den der Provence. Richtig in den Norden. Dorthin, wo ich ich immer schon meinte, beheimatet zu sein. Nach Schleswig-Holstein. Mit der Dame funktionierte es in der Gemeinschaft dann zwar nicht so recht, aber ein neues Gefühl von Heimat sollte sich einstellen. Nach einigen Jahren der Abgeschiedenheit auf einem südholsteinischen Dorf war die definitive Entscheidung gefallen: angekommen. Ein anderes Zuhause würde es nicht geben.
Nun bin ich während meiner Suche nach Heimat, während meiner Reise durch die Vergangenheit dann doch wieder im Linksrheinischen gelandet. Es hat den Anschein, mein Körper und der möglichweise dazugehörende Geist möchte doch lieber von den Fischen des Mer méditérranée angeknabbert oder aufgefressen werden; ich habe vor längerer Zeit beschlossen, ihnen das zu gönnen, was ich ein Leben lang allzu gerne mit ihnen getan habe. Es könnten auch die des Atlantique sein, da sie in ihrem Wesen mit denen der Nordsee verwandt sein dürften.
Zuvor durfte ich jedoch noch erleben, wie sich die morgensternsche These oder auch Theorie von der Verbindung zwischen Heimat und Freunden als Praxis erweist. Unweit des Rheins befindet sich ein Pungeville s. R. (letztes dürfte ohnehin für sur Rhin stehen) geheißenes Anwesen. Auf ihm befindet sich ein Haus, das nicht nur architektonisch meiner Vorstellung von Paradies gleichzukommen scheint, da es gleichermaßen lichtdurchflutete Helle und wärmende Harmonie darstellt; würde ich ein Haus bauen wollen, was mir in meiner Phantasie tatsächlich einige Male vorschwebte, es sähe ziemlich genau so aus. Und in seiner von Ruhe und Gleichmut oder auch Gelassenheit bestimmten Lebhaftigkeit des Innenlebens erinnert es mich an meine Idee des Mehrgenerationenheims, die ich Anfang der neunziger Jahre in La Rochelle gerne verwirklicht hätte, die aber daran gescheitert sein dürfte, daß es den anfänglich an diesem Vorhaben Interessierten zu sehr Utopia gewesen sein dürfte, also ein Nicht-Ort. Heutzutage gehört es fast zum Alltäglichen, sich im aufkommenden Alter in Wohngemeinschaften zusammenzutun. Der einst utopischen Wohngemeinschaft der sechziger Jahre kommt das allerdings nur noch entfernt nahe, handelt es sich bei den neueren Arrangements doch nur noch um Zweckgemeinschaften, die sich lediglich an mehr oder minder vorhandenem Geld orientiert. In Pungeville ist jedoch tatsächlich die Gemeinschaftsidee umgesetzt. Zwar handelt es sich bei den Eigentümern und Mietern ebenfalls um Menschen fortgeschrittenen Alters, aber nahezu immer sind auch jüngere oder nachrückende Generationen zu Gast. Es finden Ausstellungen sowie Theater- oder sogenannte Kleinkunstauführungen und auch Konzerte statt, und ein zum Inventar gehörender Schriftsteller ist alles andere als ein Hinterhofdichter. Nicht nur im Ansatz kommt in mir die Verbindung zur Romantik auf, deren Vorphase Aufklärung mich in jungen Jahren gar akademisch beschäftigte, in der Leben Kunst bedeutete und Kunst Leben; das vielzitierte und gerne auch falsch interpretierte L’art pour l’art ist ein Begriff, der aus dieser historischen Epoche herrührt.
Zwar weiß ich nun noch immer nicht, was Heimat bedeutet oder gar sein könnte, doch Pungeville s. R. könnte der Heimat ein Heim bieten.
* Im Deutschen kennt man den Weißwurstäquator; er kommt in der Bedeutung in etwa dem schweizerischen Röstigraben gleich. Als eine französische Grenze dieser Art bezeichne ich das Gebiet, das eigentlich eine klimatische Trennung darstellt: Einige Kilometer südlich von Lyon, etwa ab Vienne, erhellt sich alles, wird lichter, die Cigales beginnen lärmartig zu zirpen, kein von den Deutschen Heimatgefühle hervorrufender Tann trübt mehr den Blick. Nördlich dieser Sprachbarriere spricht man barbarisch. Als Barbaren werden von den Südfranzosen nicht etwa die Wikinger oder auch Germanen bezeichnet, sondern diejenigen, die stottern und stammeln. Das mag aus der Zeit herrühren, als das Langue d’oc, im Gegensatz zum nördlichen langue d'oi, noch vorherrschend gesprochen wurde. «Das Provençalische», so Michael Bengel, «war wie das Französische auch aus dem Vulgärlatein hervorgegangen, im Süden gleichberechtigt dem Latein als Amtssprache: Es war die Sprache der Verwaltung wie des Volkes — und es wurde im 12. Jahrhundert die Sprache der ersten Kunstlyrik des Abendlands.» Es war die Zeit, als die Minne sang.
Selbstverständlich haben die Pariser recht, die als einzige gutes Französisch sprechen. Allerdings vergessen die Pariser gerne, daß sie allesamt aus der Provinz kommen, aus welcher auch immer. Der Vergleich mit den Wecken gleich Schrippen in Berlin könnte zulässig sein.
Nach(t)wort
Ich habe, sowohl inhaltlich als formal, sicherlich schon Interessanteres von mir gegeben. Doch ich lebe zur Zeit unter einigen Erschwernissen, bei denen die körperlichen der leichteren, beinahe nebensächlichen Kategorie zuzuordnen sind. Die Thematik bewegt mich seit langem, und die Gedanken dazu wollten aufgeschrieben sein. Ich habe es also in erster Linie für mich in meine Kladde geschmiert. Wohl ahnend, es könnte noch einige andere Menschen interessieren, habe ich mich für die bemüht, es festzuhalten.
| Fr, 01.11.2013 | link | (7753) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
Selbstbefriedigung. Eigenherzselbstmassage. Eigenkommentar.

Cœur qui souprire n'pas ce qu'il désire. (Ein seufzendes Herz hat nicht, wonach es sich sehnt.)
Es ist offentlich, keiner will mehr mit mir spielen. Ich habe mich aber auch selbst zum Außenseiter stilisiert. Nein. Es hat lediglich den Anschein. Ich funktioniere nunmal anders als die Masse. Wenn es solche wie mich auch ebenso massenhaft gibt. Aber diese Andersschreibenden haben nunmal überwiegend ihre eigenen Seiten, auf denen sie meist unkommentiert vor sich hinschreiben. Sie haben, wie ich, ihre (vermutlich ebenso kleine) Leserschaft. Zu der ich gehöre. Ich kommentiere auch kaum. Aber kommentieren um des Kommentierens willen wäre eine Lösung, die niemandem Befriedigung verschafft. Und bei mir kommt noch hinzu, daß ich so verquast, so nach innen, häufig derart insiderisch schreibe, daß viele ob des Unverständnisses kopfschüttelnd abdrehen. Es liegt sicherlich auch daran, daß ich mir durch meine Privatisierung eine Auftrittsänderung leisten konnte.
Auch früher war ich beim Verfassen von was auch immer bemüht, die Sprache nicht in den Hintergrund treten zu lassen. Die Reduktion von Sprache zugunsten des Transports von Inhalten hat mich häufig meiner Konzentration beraubt, das Germanisten- oder Kunsthistorikergschwalle nicht minder. Es geht auch anders; glücklicherweise war ich sehr lange Zeit in führender Position der Ästhetikbranche tätig, in der ich Langeweile in Kurzweil umoperieren durfte: Unter Ästhetik verstehe ich hier ausnahmsweise das landesweit obligate Mißverständnis, das italienische Estetica, von der Nägelpolitur bis zur Brustverkleinerung. Ich habe selbst jahrzehntelang sehr diszipliniert geschrieben, schreiben müssen, sogar unter den sechs Pseudonymen oder Noms de plume (deren Praktikabilität mich in meinen Anfängen, sozusagen während eines hochbezahlten Volontariats, meine Lehrmeister lehrten) und die ich mit tucholskyischem Vergnügen weiterführte, die ich seit den Siebzigern bei der VG Wort angemeldet habe.
Doch nun muß ich endgültig nicht mehr verstanden werden — oder nur von denen, die zwischen den Zeilen lesen können. Vielleicht bin ich auch in den Altersp(r)unk geraten, der in immer dürftigere, weil minimaler (nicht minimalistischer, das ist ein Terminus technicus der Kunstschreibe, vielleicht gar als Termkuss [?] für die Neugehetzten in der SMS-1 oder in der Zwitscherschreibe2) gewordene Sprachkompositionen hineinverquert, die klingen wie eine einzige (einzigste?) Melodei und Rhythmus auf dem allabendlichen Volksmusikabend von Hessischem und Mitteldeutschem Rundfunk, dessen Niveau die anderen Bedürfnisanstalten sich zusehends annähern. Hier will ich, hier darf ich sein: mich ändern oder auch nicht.
Vorgestern schaute ich hinein in eine sogenannte Talkrunde. Gezielt. Ich glaube es selber kaum. Ich. Talkshow. Wenn ich das Wort schon lese. Unvorstellbar, aber Tatsache. Moderatorin ist eine Frau, die ich jahrelang nicht ausstehen konnte, die mir geradezu körperlich wehtat, wenn ich, was einige Male vorkam, mich in ihrer Nähe befand oder gar neben ihr stand, aber auch ihr Bild im Fernsehen war mir unangenehm. Irgendwann im Lauf des vergangenen Jahres geriet ich beim Switchen3 in eine ihrer Sendungen. Ich war überrascht von ihrer Fragestellung, nicht von der Technik, sondern von der Intention und der Intension — bei ihr werden diese beiden Begriffe noch unterschieden, wie offenbar von ihren Gästen auch, bei denen ich den Eindruck habe, daß sie größtenteils von ihr ausgewählt sind. Es sind fast ausnahmslos Menschen, die etwas zu sagen haben, auch wenn sie (oder gerade deshalb?) nicht ständig im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen oder von einer Quasselrunde zur nächsten gereicht werden. In den Sendungen, die ich mittlerweile gesehen und gehört habe, wurde nie geschleimt, kaum eines dieser üblichen überflüssigen, weil inflationären4 Wörter. Bis auf eine, der bis auf hübsch pakistanisch auszuschauen nichts anderes einfiel als in dürren Wörtchen Gott vom Islam zum Christentum, saßen da Menschen, die sich gewandelt haben oder dieselben geblieben sind, nur eben auf eine andere, wandelbare Weise, ob das die gerade in mich hineinarbeitende Entdeckung, die nachgerade unglaublich empfindsam nachdenkliche Maria Schrader, ob das der kluge Michael Groß, der Leistung völlig anders definiert als die meisten von der gerade wohl deshalb untergehenden FDP, ob das der ungemein sympathische Oboist Albrecht Mayer mit seiner in jeder Hinsicht offenen Einblicksgewährung in sein Innenleben, ob das die Moderatorin Bettina Böttinger selbst ist mit ihren gleichermaßen einfühlsamen und bisweilen gar intellektuellen Fragestellungen, bei der ich gespürt habe, daß sie sich für das interessiert, mit dem sich ihre Gäste in ihrer Berufung beschäftigen. Intensive Beschäftigung mit der jeweiligen Thematik setzt das voraus. Da dürfte das Internet nicht ausreichen..
Womit ich wieder bei dem wäre, das gestern erneut zur Sprache kam zwischen der kunstsachverständigen Frau Braggelmann und mir: das Problem des Nichtverstanden-werdens. Ihr Pflegephall, ein meines Wissen universitätsdiplomierter, gleichwohl überwiegend in der Welt des schönen Scheins unterwegs seiender Journalist eines Alters, von dem man meinen sollte, die Ironie (vom vorgesetzten Selbst- fange ich erst gar nicht an) müßte ihm wenigsten ansatzweise noch bekannt sein, versteht sie häufig oder auch fast nie. Sie hat sich deshalb zwangsweise angewöhnt, bei einem elektroschriftlich geäußerten Witzchen eines dieser Zeichen anzufügen5, die darauf hinweisen, es sei scherzhaft gemeint. Gestern früh meinte Hans-Günther Pölitz von der Magdeburger Zwickmühle im samstäglichen Kabarettportait von Deutschlandradio Wissen, es werde immer schwieriger, man könne schließlich nicht jede Pointe erklären, nur weil die jüngeren Zuschauer keine Zeitung mehr läsen oder sich überhaupt informierten. Dieser jedoch bereits in die Jahre gehende Phallus kann ebenfalls nicht lesen, nicht nur die Kurzmitteilungen von Frau Braggelmann, sondern nicht einmal das, was an scheinbaren Oberflächlichkeiten im Internet steht. Wenn zu lesen ist, ein Künstler gebe ungern Interviews, hält er das für arrogant. Ein Journalistik-Studium mit vielleicht dem Appendix Germanistik reichte eben auch früher nicht aus, zwischen dem protestantisch geprägten Hochmut (versus Demut) und einem Stolz zu unterscheiden, der sich auf das eigene Können bezieht, hier eines Großmeisters der Künste, der, wenn überhaupt, nur auf Fragen anwortet, für die derjenige, der etwas zu wissen begehrt (wobei es unerheblich ist, daß er es auch noch am Markt des Papperlapapps zu verhökern gedenkt) tief eingetaucht sein muß in ein Leben, das mit Beruf(ung) gleichzusetzen ist. Wer so schlecht selbst zwischen den Zeilen scheinbarer Oberflächlichkeiten lesen kann, dem geschieht es (recht), wenn er von dem neuen gesellschaftlichen Phänomen der bewachenden Kraftmenschen aus dem Saal entfernt wird, weil er sich auf den Menschen (der selbst gar nicht bewacht werden will, dem dieser Schutz vermutlich behördlich verordnet wurde) stürzt, um mal eben ein Interview mit ihm zu «machen». Und wenn er obendrein nicht in der Lage ist, Adressen herauszufinden (neudeutsch: recherchieren6), über die er zarte Bande für ein eventuelles Gespräch knüpfen kann, dem gebührt zu recht Platzverweis. Aber der Begriff Journalist ist ja nach wie vor nicht geschützt, auch nicht vor mir, der ich, als ich noch ein solcher war, allerdings selten weniger als zwei Tage benötigte, um mich auf ein Gespräch vorzube-reiten. Aber ich war auch nie, von meiner Zeit als Spieljunge abgesehen7, für die wohlgewandete Glanz-und-Gloria-und-Glitzer-Glitter-Fachpresse tätig, in der so etwas in ein paar Minuten erledigt ist, wenn man lediglich die Kleidergröße und den Maßschneider von Lippen und Titten wissen muß.
Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. (Wo die Ziege angebunden ist, dort muß sie weiden.)
Ich verspüre mal wieder das Bedürfnis, aufzuhören mit diesem Internetgedipple. Da ich ohnehin ein kleiner, alternder, mittlerweile nahezu bewegungsunfähiger Bücherwurm bin, läge es nahe, nach unserer Apo-Opa-Devise zu handeln: Das Bißchen, das ich lese, kann ich mir auch selber schreiben, es drucken zu lassen und es dann im Boot aus Stein (dem Lithographie-Stein?) auf der langen Reise ins Meer mit hinauszunehmen und bei der umgekehrten beziehungsweise der zeitgemäßeren Witwerverbrennung alles in Rauch aufgehen zu lassen. Aber vermutlich werde ich dann doch wieder und weiter ein wahrer Internetvollschreiber bleiben, weil ich mir einbilde, ich hätte etwas zu erzählen, sei mittlerweile gar zur Species der Zeitzeugen zugehörig (wohl deshalb gebe ich immer mehr von mir preis), zumal immer weniger Bücher gelesen werden, ich also einer dieser abtretenden Akteure oder besser Comédiens im Sinne eines molièrschen Thespiskarrens und weniger seiner dann sehr hohen, höfischen Comédie-Française oder gar des schnellebigen Filmgefitzels bin. Eher so, wie der von mir nach wie vor hochgeschätzte, nicht so adelsnahe Dieter Hildebrandt während der oben erwähnten Runde meinte: Er mache das alles nur für sich, aber er genieße es durchaus, wenn manchmal jemand applaudiere. So bleibe ich wohl bei meinem elektrischen Tagebuch, in dem ich mein Leben sortiere, ordne, die Erinnerungen während des Verfassens beim Schreiben unordentlich aufhäufe und mir dabei zuschauen lasse. Ab und an kommt ja tatsächlich mal jemand vorbei und klatscht auch bei mir. Nein, ich erinnere mich nicht schreibend, um zu verdrängen. Ich will es zurückholen. Und ich bin unheilbar mitteilungsbedürftig.
Um die Anmerkungen lesen zu können, berühre man mit dem Cursor die jeweiligen Ziffer.8
| So, 29.01.2012 | link | (5103) | 18 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
Aufrichtig sein
will ich, und hänge es Sie deshalb an die große Glocke, die Alle Jahre wieder das Jahr ausläutet, mangels bereits erwähnten Materials auch als Transparent (und damit Sie) aus dem Fenster, diese Kehrseite:
Gäbe es nicht familare Beziehungen engerer Art als die von Jutta Dittfurth erwähnte Familie des deutschen Adels (die ja weit in andere europäische Hochwohlmögendentümer hinein Blut gespendet hat), ich hätte keinen Sitz mehr in diesem blühenden Land, das derart verkohlt ist, daß viele gar nicht (mehr) sehen, was der Pfälzer alles an faulen oder künstlichen Blüten hinterlassen hat, beziehungsweise die meisten sich wohlfühlen in diesem mit Eigenschaften genannten Phrasen wie Leistung und Fleiß künstlich gegüllten Weltenfitzel.
 * Ich hatte das Glück — als Sohn einer vom Wahn eines irren, von misanthropischen Träumen des biedermännischen Kunstwerks im Gesamten geplagten Kleingeistes eingedeutschten, aber zu fragwürdigen Zeiten nie das großdeutsche Reich betretenden Mutter und einem von Briten quasi unter der Dusche weg befreiten gelbsternmarkierten Vater, den es, weil er ein fröhlicher Herumtreiber war, mehr oder minder «zufällig» erwischt hatte — zu einem Zeitpunkt des Aufbruchs ins Land gekommen zu sein, als die Vernunft endlich begann, die Würde neu zu definieren, als deren etymologische Wurzel Wert weltlich zu werten: weg vom götterhaft bestimmten Herren- und Untermenschen, von der edlen Rasse des Deutschen und den Shmoks oder Nebbichs, als die alles andere galten. Dieser pfälzische Preßsack hat alles wieder planiert, was da an zarten Pflänzchen aus dem aufbrechenden Asphalt und Beton dieses versiegelten Landes hervorzusprießen begann; der Serientrailer zu Peter Lustigs Löwenzahn ist (hier in etwa) ein Symbol dafür, daß Pracht sich auch anders ausleuchten ließ denn als höfisches (Nach-)Geplappere oder militärisches Gerassle unter demokratischem Deckmantel.
* Ich hatte das Glück — als Sohn einer vom Wahn eines irren, von misanthropischen Träumen des biedermännischen Kunstwerks im Gesamten geplagten Kleingeistes eingedeutschten, aber zu fragwürdigen Zeiten nie das großdeutsche Reich betretenden Mutter und einem von Briten quasi unter der Dusche weg befreiten gelbsternmarkierten Vater, den es, weil er ein fröhlicher Herumtreiber war, mehr oder minder «zufällig» erwischt hatte — zu einem Zeitpunkt des Aufbruchs ins Land gekommen zu sein, als die Vernunft endlich begann, die Würde neu zu definieren, als deren etymologische Wurzel Wert weltlich zu werten: weg vom götterhaft bestimmten Herren- und Untermenschen, von der edlen Rasse des Deutschen und den Shmoks oder Nebbichs, als die alles andere galten. Dieser pfälzische Preßsack hat alles wieder planiert, was da an zarten Pflänzchen aus dem aufbrechenden Asphalt und Beton dieses versiegelten Landes hervorzusprießen begann; der Serientrailer zu Peter Lustigs Löwenzahn ist (hier in etwa) ein Symbol dafür, daß Pracht sich auch anders ausleuchten ließ denn als höfisches (Nach-)Geplappere oder militärisches Gerassle unter demokratischem Deckmantel.Als ich in den Siebzigern von Berlin aus, wohin es mich nach deutschem Abitur in Skandinavien in den früheren Sechzigern, vermutlich der gemeinsamen elterlichen Zwanziger-und-dreißiger-Jahre-Schwärmereien wegen, gelockt hatte, über einige Stationen irgendwie nach München geriet, wollte ich sofort und rasch wieder weg. Die Stadt war bereits völlig verstrahlt von olympischem Glanz, der ganze Heerscharen von Provinzlern nach Isar-Athen und in trachtige oberbayerische Faschingskostüme gelockt hatte, daß vom tatsächlichen vereinzelten Charme dieser Provinzhauptstadt kaum noch etwas zu sehen war (heute glamourt auf diese Weise Berlin). Es gelang mir nicht auf Anhieb, wieder zu fliehen, die sich ausweitende Berufung ließ es nicht zu. Letztendlich trug sie jedoch dazu bei, daß ich doch fast dreißig Jahre blieb, das Ende kam erst um die Jahrtausendwende (wütender Abgesang), es wurde tatsächlich mitermöglicht durch die neuen Kommunikationstechnik eMail. Aber aus allem ergab sich eine Erkenntnis, die Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt. Wenn man ohnehin ständig unterwegs ist, dann spielt es keine Rolle, wo die eigene Hütte oder Höhle steht, in die man sich zurückziehen kann. Tatsächlich bezog ich ein halbes Jahr, bevor Tschernobyl in die Luft flog, die Wohnung in einem Hochhaus, an dem ich jahrelang mit dem Gedanken vorbeigefahren war, darin nie wohnen zu wollen. Damit festigte sich die moralische, aber von den meisten nicht umgesetzte, also auch in mir bis dahin nicht wirklich oder ernsthaft verankerte Theorie, das rein Äußere habe keinen inneren Wert. Und richtig, ich durfte ins Innenleben dieses Hauses gehen, in eine der schönsten Wohnungen einziehen, die ich bis dahin gesehen hatte. Der Architekt des in den Anfängen der Sechziger errichteten Hauses hatte es nämlich geschafft, die positiven Eigenschaften der Bauhaus-Idee, die Idee des Neuen Bauens vom neuen, auch von mehr Kapazität geprägten Denken neu überdacht fortzusetzen. Es war also eine Wonne geworden, von meinen Reisen zu Renaissance-Pracht und (vor allem in den Palästen so manches Mal vermeintlicher) Kunst-Transparenz heimzukommen in meine von Helligkeit durchflutete, in schlichter Schönheit strahlende Höhle ziemlich weit oben.
Die habe ich jetzt auch in meinem Zuhause südlich und nördlich. Nördlich jedoch wirklich nur noch wegen der bereits erwähnten familiaren Bindungen, die mir, trotz oder möglicherweise gerade wegen meiner inneren Heimatlosigkeit viel bedeuten. Im deutschen Land komme ich kaum mehr herum. Meine paar Ausflüge nach Hamburg, Lübeck et cetera reichen mir völlig aus. Nicht nur die zusätzlichen Ausreiser aufs Land tragen zum Rest bei. Herbert Achternbusch hat es zwar vorgemacht: Dieses Land hat mich kaputtgemacht. Jetzt bleibe ich solange hier, bis man es ihm ansieht. Aber weder ihm noch mir ist es gelungen. Man sieht es ihm nicht an, daß es sogenannte Andersdenkende gibt. Ich weiß, daß es sie gibt. Aber ich sehe sie, seit ich aus meinem Elfenbeinturm Berufsleben heraus bin (was ich wahrlich nicht beklage, sondern mich erfreut, weil ich nicht mehr in diese Artistenzirkuskuppeleien reisen muß, in denen nur noch monetär geturnt wird), nicht (mehr). Bisweilen komme ich in Kleinstädte. Da fühle ich mich nahezu ausnahmslos wie in Lethes Freibrief von Herbert Köhler aus dem Jahr der anderen Wende, der des Jahrtausends, in dem er von Diogenes erzählt, «der am helligten Tag mit einer Laterne über die Athener Agora spazierte und gefragt wurde: ‹Was tust du mit dem Licht?› und dann erwidert haben soll: ‹Ich suche Menschen!› » Manchmal komme ich auch ins Krankenhaus, so kürzlich. Da hatte man mir, als ich, bereits kontrastmitteldepressiv leicht geschädigt, dem angiologischen Computertomographen entronnen war, einen um einiges älteren Herrn ins Zimmer geschoben, der zunächst keinerlei Anzeichen eines größeren Schadens erkennen ließ.
Sonnengebräunt war er, ebenso seine später zu Besuch kommende Gattin, noch vom letzten Türkei-Urlaub, dreimal jährlich mindestens mit dem Superbilligflieger von Blankensee aus, zu irgendwas müssen diese von Steuergeldern getragenen Flughäfen schließlich gut sein, und, von seinem altersbedingten Schmerz abgesehen, also guter Dinge. Und da man sich des gemeinsamen Schnarchens schon sicher ist, muß man sich auch besprechen. Daraus wird dann, wenn man einen Zuhörer hat, eine Rede. Zum Beispiel eine über die faulen Griechen, denen man's vorn und hinten reinschiebt, überhaupt diesem ganzen faulen Restpack im Süden Europas. Als dann meinerseits eine leise Gegenrede kam, nämlich die, er habe noch gar nicht irgendwem etwas irgendwo hineingeschoben, sondern das seien zunächst einmal nichts als Bürgschaften, da kam fast wutschnaubender Protest. Aber so höre und lese er es doch tagtäglich im Fernsehen und in der Zeitung. Ach ja. Ich habe mich dann aufs Private beschränkt. Nicht nur der junge Mensch des Medienzeitalters erzählt ja gerne von sich. So hörte ich zwischen den Zeilen heraus, welcher Abkunft er ist: gut versorgter, mit einer Witwenrente zusätzlich aufgebesserter vermutlich traditioneller sozialdemokratischer Hausmeister, dem die Juristerei seiner Gewerkschaft wegen eines Sportunfalls in jungen Jahren durch einige Instanzen zu einem weiteren Zubrot verhalf. Ein bißchen ließ ich ihn dann noch, bevor ich erschöpft die Ohren zuklappte, über das Gesundheitswesen schimpfen, an dem alleine die da in Brüssel schuld seien. Über die Ärzte der Universtätsklinik zu Lübeck schwieg er.
Von denen hatte eine gute Woche zuvor der Angiologe gesprochen, zu dem mich mein Hausarzt geschickt hatte. Der machte mir von vornherein unmißverständlich klar, daß er mich in keine dieser quasi staatlichen Krankenhäuser überweisen würde, sondern nur, der Versorgungsqualität wegen, in ein privates. Solllte ich eine Staatsklinik bevorzugen, dann müsse ich das selber in die Wege leiten. Das habe ich dann getan, wo ich sowohl die fachliche als auch die soziale Kompetenz von mindestens vier jüngeren Ärztinnen und Ärzten samt freundlichem, geradezu liebevollem Pflegepersonal feststellte. Mit allen hatte ich Gespräche, aus denen ich einmal mehr heraushörte, wie, nach meiner Sprach- und Denkgestaltung, unwürdig sie doch behandelt werden. Diese ungemein kommunikativen, im persönlichen Gespräch mit mir aufgeräumten, nachgerade fröhlichen Mediziner erkannte ich nicht wieder, als sie zur Visitenkarawane aufmarschierten. Die Köpfe zwischen die Schultern eingezogen, fast duckmäuserisch standen sie da und sprachen kein einzig Wort. Das hatte allein der Ober- oder auch Chefarzt, der mich nicht einmal anzuschauen in der Lage war, während er über mich, über meinen Körper redete.
Sechs Jahre, so erzählte mir der noch in der angiologischen Lehre befindliche angehende Internist, während er mir in geradezu liebevoller Handarbeit die nach der Operation sich nicht verschließen wollende Arterie mittels Kompression wieder dichtmachte, müsse er über seine «normale» Ausbildung hinaus ran. Auf rund zehn Jahre hochgerechnet habe ich's. Um dann als Facharzt während der Visite vor dem Chef zu ducken, der sich aufführt, als ob er von altem Adel wäre (wie diese Species sich im privaten Bereich verhält, habe ich in meinen jahrzehntelangen Erfahrungen mit ihnen häufig genug erlebt: wie jedes andere Lieschen und Fritzchen Müller auch). Da wundert sich mein in der Türkei sportiv gestählter Rentner, aber auch die täglich wegen eines Hüsterchens auf der Matte stehende Patientin von Frau Braggelmanns Chefin, daß die alle ins Ausland abhauen, weil sie dort wenigstens angemessen bezahlt werden. Aber davon, daß jetzt auch noch der letzte Rest des ursprünglichen Tafelsilbers an Investoren verhökert werden soll wie griechische Bunga-Bunga-Inseln an Berlusconis oder so, davon haben sie noch nie etwas gehört, geschweige denn gelesen, weil Information ihnen zu anstrengend ist. Die Universitätsklinik Lübeck, so las ich, soll nun, wie andere öffentlich-rechtliche Krankenhäuser auch, komplett privatisiert werden. Weg mit dem Rest des vom Steuerzahler finanzierten Eigentums in den Hals derer, die mit ihren grundseriösen Gewinnerzielungsbsichten ihn nicht voll genug kriegen können.
Das ist ja nun alles nichts neues. Aber dieses ewige Geschimpfe und Gegreine hierzulande, dieses ständige Schuldabschieben auf andere, diese, das ist das Allerärgste, diese gehorsam in diesen Kadavern steckende Schicksalsergebenheit, die macht mich fertig. Wird in Frankreich, in Italien, Spanien oder sonstwo zu recht gestreikt, weil ihnen diese ganzen weltweiten Wirtschaftswachstumskapitäne mit ihren politischen provinziellen Lotsen, die gerne auch ein wenig von diesem Glanz abhaben wollen, die Kähne auf Grund gesetzt haben, dann wird gemault, dieses faule Gesocks vernichte deutsche Kaufkraft. Um dann wieder mit dem koreanischen Dieselrennpanzer von Billigheimer zu Billigheimer brettern, um noch billiger Bio aus China einzukaufen. Und im Sommer düsen sie dann wieder nach Türkesien, um sich zu beschweren. Denn das können sie, das hat ihnen das Fernsehen, nicht nur das öffentlich-rechtliche, eingetrichtert, wie der Gans und der Ente den Maisbrei zu Weihnachten: Sie haben Rechte! Aber solche Sauereien essen sie ohnehin nicht. Denn das ist Tierquälerei. Im Gegensatz zum preisgünstigen, kiloweise nachhause geschleppten antibiotischen Geflügel, Rind und Schwein.
Vorhin rief mich Frau Braggelmann an und erzählte einmal mehr begeistert vom schönen Leben im Hotel. Seit einiger Zeit greift sie mein Genuß-Prinzip auf, nach dem es einem selbst und auch anderen wohler tut, sich selbst Gutes zu tun, zum Beispiel lieber etwas weniger zu nehmen und dafür Besseres. Und da sie ein freundlicher und überaus kommunikativer Mensch ist, kommt sie immer auch mit Menschen ins gute Gespräch, die Dienste leisten, weil es ihnen Freude bereitet, dienstzuleisten. Und wie das eben so ist, wenn man gerne von innen heraus ein höflicher Mensch ist und zuvorkommend und mit den Menschen auch ohne Gewinnerzielungs- oder sonstige Absichten dieser Art spricht und so gute Kontakte sich ergeben, dann kann's ohne weiteres geschehen, daß man zu Silvester zum Normalpreis in eine Suite eingewiesen wird. Wer andere als Personal behandelt, das gefälligst zu tun hat, was man fordert, wer als Möchtegern-Adliger den Diener braucht, den man anzublaffen gedenkt, dem wird's das Pauschaltouristenhirn vertrocknen.
Ich aber, ich habe den Kanal voll. Ich mache Schluß mit Achternbuschs Ansichten. Ich mache es auch nicht wie seinerzeit Franz Josef, der das Land verlassen wollte, um Ananas zu züchten in Alaska. Das klingt mir zu sehr nach Arbeit. Ich bin nämlich ein adoptierter Südländer, eine faule Sau, auch noch eine jüdische, und dann noch so eine durch und durch säkularisierte. Ich lege mich in die Hängematte. Aber nicht in diesem Land, in dem spätestens seit der vereinigten Kohl-Düngung definitiv keine Bäume mehr wachsen wollen, wo man sie festbinden könnte. In dem man überhaupt Hängematten nicht mag, weil sie eine Gefahr wider Fleiß und Ordnung symbolisieren. In dem man fränkisch arbeitssame Freiherren über alle Maßen schätzt, die zwar nicht einmal abschreiben können, dafür von edlem Blut sind. Wie hat mir gestern unser Jüngster erzählt, wie die Jugend mittlerweile spricht? Spieken heißt jetzt Gutenbergen.
* Gelbstern auf halbierter Verlegenheits- oder auch Notbehelfs-Kippah, hergestellt von einem handwerklich begabten, mehr oberbayerisch als katholisch, sich trotzdem keineswegs als Künstler verstehenden Steinmetz-Freund zur Veröffentlichung bzw. von Redaktionsmitgliedern handgefertigt als Beilage zu Referenz und Gedenken zweier Freunde und überhaupt in Laubacher Feuilleton 5.1993
| Fr, 30.12.2011 | link | (3547) | 3 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
Auf der Suche nach der verlorenen Identität
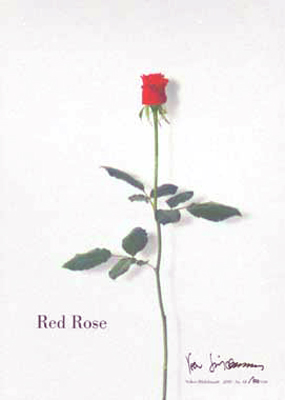 Über das Alter sprachen wir, der an Jahren auch nicht mehr so ganz Frische und ich, der in meiner Jugend von Zukunftsweisen darüber belehrt worden war, daß ich in meinem heutigen Alter ziemlich über das Verfallsdatum hinaus gewesen wäre. Allenfalls noch tägliches Rasenmähen, Laubrechen und überhaupt den Garten sauberhalten durch den vitalen Einsatz von chemischen Vernichtungsmitteln von Unkraut würde mein Leben als Rentner noch erträglich machen, in dem es ansonsten kaum noch etwas zu tun gäbe. Wobei des anderen Gedanken sich ausgesprochen mit meiner Parallelwelt verquickten und wir gemeinsam auf den Punkt kamen, ach, das vielzitierte Unkraut und so, das vergehe ohnehin nicht, und ob's das überhaupt gebe, auch eine rote Rose sei nunmal eine Art eßbares Kraut, ob sie nun aus Afrikas Gewächshäusern zu den Billigheimern angeflogen käme oder auf einem Grabstein für die Ewigkeit dahinwelke oder gar in einen solchen hineingemeißelt sei, letztlich gehe es bei den Rösleins doch nur immer um ein und dasselbe, zähle am Ende nur die Liebe wie bei Frau Stein. Und schließlich sei das heutzutage ohnehin kein Alter mehr, fügte er mit dem Nachdruck einer gehobenen Augenbraue an. Wahrlich, dachte ich so in mir drinnen für mich hin, Unkosten gebe es ja auch nicht, allenfalls Belastungen, die man sich selber auferlege, überdies fingen viele mit siebzig an, sich mittels Motorsegler in den Himmel zu erheben, gleichwohl mit Fallschirm versehen, oder sich in die Hölle zu stürzen, vorsorglich durch ein Gummiseil gesichert. Kurz ins Grübeln kam ich noch, da ich mich zu erinnern gezwungen war, daß mein Vater seinerzeit kurz vor Vollendung seines siebten Jahrzehnts war, als mein erster Schrei ihn ein wenig, in Maßen auch die damals vierzigjährige Gefährtin und zu dieser Zeit alles andere als junge Mutter, aber keinesfalls die Welt beglückte.
Über das Alter sprachen wir, der an Jahren auch nicht mehr so ganz Frische und ich, der in meiner Jugend von Zukunftsweisen darüber belehrt worden war, daß ich in meinem heutigen Alter ziemlich über das Verfallsdatum hinaus gewesen wäre. Allenfalls noch tägliches Rasenmähen, Laubrechen und überhaupt den Garten sauberhalten durch den vitalen Einsatz von chemischen Vernichtungsmitteln von Unkraut würde mein Leben als Rentner noch erträglich machen, in dem es ansonsten kaum noch etwas zu tun gäbe. Wobei des anderen Gedanken sich ausgesprochen mit meiner Parallelwelt verquickten und wir gemeinsam auf den Punkt kamen, ach, das vielzitierte Unkraut und so, das vergehe ohnehin nicht, und ob's das überhaupt gebe, auch eine rote Rose sei nunmal eine Art eßbares Kraut, ob sie nun aus Afrikas Gewächshäusern zu den Billigheimern angeflogen käme oder auf einem Grabstein für die Ewigkeit dahinwelke oder gar in einen solchen hineingemeißelt sei, letztlich gehe es bei den Rösleins doch nur immer um ein und dasselbe, zähle am Ende nur die Liebe wie bei Frau Stein. Und schließlich sei das heutzutage ohnehin kein Alter mehr, fügte er mit dem Nachdruck einer gehobenen Augenbraue an. Wahrlich, dachte ich so in mir drinnen für mich hin, Unkosten gebe es ja auch nicht, allenfalls Belastungen, die man sich selber auferlege, überdies fingen viele mit siebzig an, sich mittels Motorsegler in den Himmel zu erheben, gleichwohl mit Fallschirm versehen, oder sich in die Hölle zu stürzen, vorsorglich durch ein Gummiseil gesichert. Kurz ins Grübeln kam ich noch, da ich mich zu erinnern gezwungen war, daß mein Vater seinerzeit kurz vor Vollendung seines siebten Jahrzehnts war, als mein erster Schrei ihn ein wenig, in Maßen auch die damals vierzigjährige Gefährtin und zu dieser Zeit alles andere als junge Mutter, aber keinesfalls die Welt beglückte. Wie alt oder jung also man sich fühle. Das letzte Gespräch lag einige Jahre zurück, aber es war, als ob einer von uns lediglich kurz abgelenkt worden wäre und den Austausch direkt fortsetzte, wie das so ist bei Veranstaltungen, die wir beide nicht sonderlich schätzen, die zu besuchen wir aber beruflich genötigt waren, bei denen selbst in der verstecktesten Ecke jemand vorbeikam, den man kannte und zu begrüßen hatte, manchmal auch wollte, weil es schließlich auch auf den zu seelenlosen, zum Event verkommenen Kunstmärkten Menschen gibt, die interessant oder sympathisch oder etwas ähnliches sind und mit denen es durchaus, also nicht nur nach Rockkonzerten, glücklich beisammensitzen war. Es lag in der Natur unserer Begegnung, daß wir über Kunst sprachen. Doch die war, wie bei unserem letzten Gespräch, beinahe marginalen Charakters, wenn sich das so bezeichnen läßt bei Menschen, in deren Tages- wie Nachtgeschäft Arbeit und Leben eins sind, die sich des Privilegs bewußt sind, nicht trennen zu müssen zwischen dem mittlerweile zum Job mißratenen Broterwerb und der Freizeit, die sich nie auf die schönste Zeit des Jahres freuen müssen, weil es die nicht gibt in der eigentlichen Romantik, in der nämlich nicht das ach so romantische Wochenenddinner bei Candlelight im Wellnesshotel oder am Ende gar gleich drei davon hintereinander zählen, sondern Kunst und Leben identisch sind. Wir waren uns (mal wieder) einig, und herhalten mußte einmal mehr der Falentin Karl: Fremd ist der Fremde nur in seiner Bestimmung. Zwangsläufig kam der Gesprächspartner also auf einen Künstler zu sprechen. Über dessen Frische habe er als junger Mensch sich immer so gewundert, daß er ihn, siebzig sei er damals gewesen, der andere, gefragt habe, wie er das bloß so mache, daß er auf ihn immer so jugendlich wirke. Die zentrale Antwort habe gelautet:
Nun ja, Identität hin oder her — nun kommt wieder so ein verfluchtes, verherbstetes Wochenende, während dem man nicht einmal einfach Laubsaugen oder -blasen oder Holzkreischsägen oder rasend Mähen darf. Nur noch Lyrisches hören und lesen. Was ist das denn für ein Leben?!
Eine Menge romantische Links und überhaupt Hoffnungsloses.
| Fr, 28.10.2011 | link | (2359) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
Widerruf ist Widerruf ist der Stein der Erotik
An die vorderste Front gestellt sei das, nicht zuletzt deshalb, da ein Entschluß, etwas zu tun, wie sinn- oder gehaltvoll der auch sein mag, offensichtlich immer noch am meisten Aufmerksamkeit erregt. Kommentare geraten bei dem üblichen Leseverhalten, das ist belegt und auch bereits mehrfach kommentiert, häufig unter die Last der Zweit- oder überhaupt Hinterrangigkeit und machen sich so selber platt. Nur was auf Seite 1 und in möglichst großen, bildhaften Lettern erscheint, mag es noch so wieder- oder überholt sein, begleitet von großflächigen, den Inhalt erklärenden Illustrationen, erweckt Interesse, je größer die Armseligkeit, um so erhöhender.

Etwas endgültig habe ich bislang ohnehin noch nie etwas gemacht. Dazu mache ich mir dann doch immer wieder zuviele Gedanken, selbst dann, wenn ich eigentlich keine Freude daran habe. Ich bin, wenn ich darüber mal so richtig nachdenke, letztlich immer das gewesen, was man früher als wankelmütig bezeichnete und man heutzutage wohl als entscheidungsunfreudig nennt. Aber dennoch oder auch deshalb hatte ich mich wohl einem völlig irrationalen Druck ausgesetzt, immer wieder etwas präsentieren zu müssen, als ob ich brav meinen Tag- und Nachtschichtdienst absolvierte. Ich bin wahrscheinlich genauso virusverseucht wie diejenigen, denen ich diesen völlig abwegigen Arbeitseifer vorhalte, der vermutlich daraus resultiert, daß sie nichts angenehmeres und schöneres zu tun haben..
Hin und wieder mein feuilletonistisch verbogenes Fingerchen zu erheben, das hatte ich allerdings ohnehin durchaus vor. Aber daß ich gestern den ganzen Tag geschlafen und, entgegen meinen Lebensgewohnheiten, nicht einen Kaffee getrunken, obwohl keine Männergrippe mich aufs Lager schmiß, dafür aber übermäßig viel Schokolade gegessen und in die Ferne gesehen habe, das werde ich auch weiterhin nicht erzählen. Ich schaue mir, obwohl das ja, wie mir das öffentlich-rechtliche Fernsehen und noch ein paar andere mediale Gaukler vermitteln möchten, mittlerweile gesellschaftsfähig sei, mir schließlich auch weiterhin keine mir weitgehend unbekannte Persönlichkeiten prominenten Lebens an, die ein offenbar herbeigesehntes Gemeinschaftsverständnis vorleben, das geprägt ist von höchstproteinhaltigen Menues eigentlich dschungeleinheimischer Bevölkerungen mit anschließendem Erbrechen ihrerselbst (Zappzappzerrapp). Ein Pauschaltourist war ich nie. Da sieht man nämlich nichts, aber auch gar nichts, es sei denn vollends in die Röhre. Andererseits ist der Tunnelblick ja mittlerweile zum Bildungsideal erhoben worden.
Über Skat habe ich etwas liegen. Das wird wohl kommen, auch wenn ich davon, wie bei nahezu allem hier Veröffentlichten, nur Bruchstückhaftes verstehe. Aber «das hilft dem Vater auf die Mutter», sagt jemand, der (wie hier) einen fetten Stich gemacht hat. «Noch einmal, sagt das Mädchen.» Also einmal noch bestimmt. Und, wer weiß, wenn die Lust, die das Mädchen geschaffen hat ... Ich hab schließlich nichts anständiges gelernt.
| Do, 20.01.2011 | link | (3231) | 5 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
Aufhören werde ich
wohl hier in nächster Zeit. Zwar bin ich wahrlich kein Quotenjager, das liefe mir zuwider. Aber es geht mir durchaus auf die Nerven, daß meist nur dann sich Menschen sich hier einklicken, die aktuelle Bezüge benötigen für ihr Seelen- oder sonstiges Heil. So beginne ich mich zu verabschieden; angekündigt hatte ich's bereits. Aber ein paar Tropferl wird's sicher noch geben.
Ich bin dieser neuen Generation nicht mehr gewachsen. Das war wohl immer so. Aber diese postpostmoderistische protestanisch-kapitalistische, alles einsegnende, mittlerweile christlich-jüdisch genannnte Gleichgültigkeit bringt mich um.
Machen Sie sich am besten weiter keine Gedanken — ich bin ohnehin über das heutzutage wirtschaftlich a(n)visierte Rentenalter hinaus. Traumschiffereien waren nie meine Ebene. Machen Sie's besser.
| Mi, 19.01.2011 | link | (2949) | 24 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
Eine Anmerkung
zu den Beiträgen, die unter savoir-vivre gelistet sind: Es handelt sich dabei um (kürzlich in meinem Archiv entdeckte) Original-Beiträge für ein seinerzeit in München erscheinendes Monatsmagazin, die ich im hier aktuellen Zustand lediglich in die ursprüngliche Form zurückversetzt habe, also in den Manuskriptzustand vor der Bearbeitung durch die Redaktion. Daß ich sie hier nach so langer Zeit sozusagen neu in die Welt setze, ist mir insofern ein (auto-)biographisches Bedürfnis, da es einen mich prägenden Abschnitt meines beruflichen Lebens darstellt, das vom privaten nie zu trennen war und ist.
Hyperlinks, die es seinerzeit noch nicht gab – man hätte sich allenfalls mit (von mir überaus geschätzten) Fußnoten zu begnügen gehabt –, habe ich deshalb jeweils, zugestandenermaßen teilweise nicht ganz ironiefrei, gesetzt, um auch jüngeren Lesern einen Zugang zu verschaffen.
| Mi, 05.01.2011 | link | (1137) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
Antwort für Enzoo
(nicht zu verwechseln mit meiner geliebten und verehrten Enzo Enzo, sondern Fragesteller in Sachen Glauben drüben im Wahrnehmungsfenster der Seemuse. Da es eher zu meinen Innereien gehört, stelle ich es leicht abgeschirmt hier ein.
Weggesperrt war ich nicht. Aber in einer Art Elfenbeinturm oder besser mehr oder minder gepanzertem Glashaus befand ich mich durchaus. Als Schutz gegen die bösen Psalmen- oder Surenschmeißer et cetera dieser Welt galt der freie Blick auf sämtliche Horizonte, und jede Frag(würdigkeit) wurde auch dem Kind gegenüber (auf-)geklärt. Diesem patriarchischem Gebot hat sich sogar meine ansonsten sehr selbstbewußte und eher dominante Mutter unterworfen, selbst bei Abwesenheit meines Vaters, was überwiegend der Fall war. Hinzu kommt, daß wir während meiner gesamten frühen Kindheit beinahe jährlich in ein anderes Land zogen, so daß es kaum zu vertiefbaren Kontakten mit anderen Menschen kommen konnte. Erst zu Beginn meiner frühen Jugend kam ich (auf meinen Wunsch hin) in ein Internat, in dem sich ausnahmslos ebenfalls Kinder von solchen Weltreisenden aufhielten, bei denen Glaubensfragen so gut wie nie zur Sprache kamen. Man mag diesen merkwürdigen Sozialisierungsprozeß beurteilen, wie man mag, und zweifelsohne hat er zu einer nicht ganz unproblematischen Bindungs(un)fähigkeit geführt, die unter anderem dazu führte, daß ich mich im Alter von fünfundzwanzig Jahren (da war mein bereits neunzigjähriger, also wahrlich alter Herr des Jahrgangs 1875 bereits fünf Jahre tot) von aller Blutsverwandschaft getrennt habe. Glaubensfragen spielten dabei durchaus eine, wenn auch nebensächliche Rolle. Auslöser war dabei mit eine nicht ganz schmerzfreie Zeit der Suche – aber eben die nach (geistiger) Freiheit. Sie verbindet mich bis heute gedanklich tief mit meinem Vater.
| Mo, 18.10.2010 | link | (2873) | 3 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
Olga, die Gräfin und die Sprache
Bei Aléa Torik las ich soeben eine zauberhafte Geschichte über ein Frauenfrühstück. Sie endet mit einer Absage an nationale Kulturen, Sprachen und Fußballmannschaften; schließlich gehe es auch ohne Männer. Die darin erwähnten Olga und der Wodka haben mich an etwas erinnert, das mir seinerzeit sprachlos endlich eine Heimat zuwies.
Eine Gräfin gab es (und gibt es vermutlich noch), die ich als abstammungsgemäß hoch und gerade aufgerichtete blondblauäugige preußische Dame mit entsprechend guten Manieren samt Ehemann und Kind kennengelernt hatte. Sie hatte sich einen auch mir bekannten Herrn zugelegt, einen nicht minder, aber gänzlich anders attraktiven Bulgaren mit einem Teil russischen Adelsblutes in sich, verheiratet mit einer Spanierin und Vater zweier niedlicher Töchter. Ihm war sie an den altaiischen Rand der Mongolei gefolgt, wo er einen Film drehen wollte über eine Gruppe von Künstlerkollegen. Begegnet war er denen in Moskau während eines alltäglich-fröhlichen Zusammenseins, das hierzulande vermutlich als grauenvolles Besäufnis gewertet würde. Etwa ein halbes Jahr später kamen die beiden zurück, um den Film über die Artisten sowie sie selbst und deren Kunst vorzustellen. Die Gräfin betätigte sich seit einiger Zeit als Galeristin, der Filmer hatte mich zu deren Stand auf einer internationalen Kunstschau gebeten, um mir das Ergebnis der monatelangen Dreharbeiten zu zeigen und mich den Kollegen vorzustellen.
Wie die Wächterin eines Großkolonialreiches stand die Dame vor dem Eingang zu ihrer temporären Galerie, ihre knapp ein Meter fünfundachtzig in Hüfthöhe leicht eingeknickt, in der rechten Hand eine Flasche russischen Wodkas, die sie nur kurz weggab, um anderen auch einen Schluck zu gönnen. Sie hatte in den Jurten der Mongolen das Trinken gelernt, vielleicht war es auch während des anschließenden Aufenthaltes in Moskau, so genau erinnere ich mich nicht mehr daran. Auf jeden Fall kreiste die Flasche, mit dem Erfolg der Verständigung. Die Künstler sprachen nämlich lediglich ein paar Brocken Französisch, und ich ebensolche Russisch (aber auch nur, wenn adäquater Spirit in mich gefahren war) oder was auch immer an Sprache zum Gespräch hätte beitragen können. Ich blieb dennoch die restlichen Stunden des Tages am Platz, und gemeinsam verbrachten wir anderenorts den Abend und die Nacht, zumal noch ein paar Damen aus dem Ural und Kasachstan sowie Usbekistan hinzugekommen waren, die ebenfalls Westkarriere zu machen sich vorgenommen hatten, jede wohl auf ihre Weise. Mit ihnen mischten sich Bruchstücke in unser babylonisches Gewirr, die sich nach Englisch anhörten, aber nicht weiter benötigt wurden.
In den frühen Morgenstunden stellte der beharrliche Kreis nach einer Frühstücksrunde reinen Wodkas, inganggesetzt vom kaum mehr wahrnehmbaren Augen-Blick eines dieser mongolischen Steppendiaten, einstimmig meine Herkunft fest — einer der ihren sei ich, mit Sicherheit unter freiem Himmel in die Welt geworfen, alleine an meiner trinkerischen Mentalität sowie meiner kauernden Haltung sei das ablesbar. Was mein Vater immerfort angestrebt hatte mit seinen schwärmerischen Erzählungen von der sibirischen Heimat, in der ich schließlich als Kleinkind einmal gewesen und die nicht zuletzt deshalb auch die meine sei, was von meiner Mutter aber immer abgetan oder gar niedergeredet worden war, dessen wurde mir also vor etwa fünfzehn Jahren dämmernd gewahr: Auch ich bin, Globalisierung hin oder her, einer von drüben, aus dem Osten.
Heimat gibt es auch ohne einheitliche Sprache. Hauptsache, es ist genügend Wodka da.
| Di, 15.06.2010 | link | (4198) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
«Weniger Geld!» für Ärzte
Diese Forderung las ich in der Feldpost, in der ich mal wieder gestöbert hatte. Zunächst regte sich Widerspruch, bin ich doch der Meinung, daß Mediziner, zumindest die der Krankenhäuser, für Einsatz und Leistung zuwenig Lohn erhalten; auch von manch einem Allgemeinarzt meine ich das. Doch dann tat ich, was eben getan werden muß, ich las weiter. Und ich begann, angesichts der geschilderten Erlebnisse nicht nur zu verstehen, auch setzte der bei mir mittlerweile gefürchtete Mechanismus der Erinnerung ein und begann zu relativieren.
Anfang der Neunziger folgte ich, wie sich das gehört für einen sich zwar in Richtung Jahre bewegenden, aber eben dennoch zukunftsorientierten Mann, der Gefährtin. Sie bewegte sich auf zwei, ich hinterher auf vier Rädern. Ein anderer Verkehrsteilnehmer stieg aus seinem Automobil aus, vergaß dabei allerdings, vorab in den Rückspiegel zu schauen. Worauf meine Schönheit mit einem Mal nicht mehr so zauberhaft aussah, denn durch Außergewöhnlichkeit verursachte Schmerzen, wie ich gerade wieder lesen mußte, können Gesichter entstellen. Der Lenker der Voiture war recht entsetzt über seine zweifelsohne unvorsätzliche Körperverletzung und über alle Maßen bemüht, seine Schuld anzuerkennen. Aber ins Krankenhaus wollte ich meine Geliebte dann doch lieber selber fahren, zumal ich meinen Wagen direkt hinter der Gestürzten zum Stehen gebracht hatte. Es folgten unangenehme Stunden im Schwabinger Krankenhaus, nicht so sehr für die Gefährtin, deren Schmerzen abgeklungen waren, wir aber sichergehen wollten, daß am Bein oder gar am Kopf möglicherweise nicht doch etwas Schlimmeres kaputtgegangen sein könnte, sondern wegen des wartenden Stöhnens der anderen ihrer Not wegen Aufgenommenen, denen es seit langem weiterhin wehtat, wobei vereinzelt nicht einmal dem Blutfluß ernsthaft Einhalt geboten wurde. Man könne es eben nicht ändern bei dem Andrang, teilte mir eine junge Ärztin lakonisch auf meinen Hinweis auf die vier oder fünf jammernd auf Bahren Herumliegenden mit. Die seinerzeit von mir nicht Trennbare wurde als leicht lädiert entlassen, wurde später dann auch Mutter, wenn auch nicht von mir.
Gute fünf oder sechs Jahre später, sie befand sich längst in besserer Obhut an einem anderen Ort, lag ich am Boden, ganz woanders und sicherlich noch immer ein wenig beeinflußt von den Spätfolgen dieser Trennung. Kein unachtsamer Autofahrer hatte mich niedergestreckt, auch nicht die Kunst in Massen, der ich zu diesem Zeitpunkt ansichtig zu sein hatte, sondern ein Defekt in mir, der sich zunächst wie ein Kreislaufversagen anließ. Es hätte auch eines des Herzens sein können, nicht unbedingt der entzückenden champagnerservierenden Dame, sondern (m)einer möglicherweise schadhaften Pumpe wegen. Wäre es so gewesen, ich Glücklicher hätte mich mitten in all den kunstvollen Gemälden und Plastiken und Skulpturen und Videos verabschiedet, wie der Cowboy, der mit den Stiefeln voraus aus dem Saloon getragen werden möchte, denn die im Haus stationierten Sani-Täter benötigten für ihre Anreise fast eine halbe Stunde, um mich zum um die Ecke ausgerechnet auf mich wartenden Notarzt zu transportieren. Zwar war ich nicht ganz bei Sinnen, aber an die Witzchen über mich und meinen Zustand erinnere ich mich noch heute recht gut. Nun, in diesem Beruf benötigt es wohl den Panzer des Zynismus, um diesen Alltag nicht in sich eindringen zu lassen.
Flugs, also etwa eine Stunde später, schließlich war zunächst die Versicherungsfrage zu klären, da die Technik noch in den Anfängen steckte und folglich die in dem Kärtchen verborgenen Daten nicht lesen wollte, karrte man mich ins nächstgelegene Krankenhaus. Dort rätselten die Fachleute, auch sie ständig witzelnd, quer durch alle Körperfunktionen jedes Erdenkliche, das seinen Höhepunkt schließlich in einer Magenspiegelung fand, die am nächsten Tag vorgenommen werden sollte. Für diesen Zweck legte man alle möglichen Pipelinen hin mich hinein und schmiß mich nach wie vor bekleideten Corpus delicti anschließend samt Schuhen an den Füßen lieblos in ein Bett der Intensivstation, direkt neben einen frisch Operierten, den sie ohne weitere Maßnahmen wieder zugeklappt hatten, weil die Metastasen in ihm bereits wie weiland die Germanen zur Wanderung quer durch den europäischen Körper unterwegs waren, hier einer, der die Nacht vermutlich nicht überstehen würde. Einiges an Kenntnissen und Erfahrungen zum Thema hatte ich, da mein Bekanntenkreis sich immer irgendwie zumindest teilweise aus Medizinern zusammensetzte; seltsamerweise hat sich das bis heute gehalten. Mir war nicht wohl, nicht nur bei dem Gedanken an diese Diagnostiker und die sich möglicherweise im weiteren ergebenden ärztlichen Maßnahmen, hörte ich doch aus vielen Gesprächen mit denen heraus, die immer gerne in der Nähe unklarer Fälle herumstehen: Chirurgen haben ihren Beruf deshalb ergriffen, weil sie vor allem eines wollen: anderen tief ins Fleisch schneiden. Deshalb entfloh ich frühmorgens heimlich aus dem Hospital und ließ mich ins Hotel fahren. Dort rief ich eine medizinisch versierte Freundin an und bat sie, mich von diesen ganzen lästigen Kanülen zu befreien. Mit dem Taxi schaffte ich es bis in deren Wohnung, wo ich ihr eine Stunde später von der Couch rutschte, dabei alle erdenklichen Körperflüssigkeiten abgebend. Sie wußte, welche Nummer sie zu wählen hatte. Wie mir später berichtet wurde, waren die Blaulichtler von der Apoplexieabteilung eine Minute später bei mir, holten mich zunächst einmal ins Leben zurück, setzen mich anschließend in einen Rollstuhl und fuhren mich, jedes Schlagloch umschleichend, auf daß kein eventuelles Gerinnsel sich lösen möge, in die neurologische Station der örtlichen Universitätsklinik. Ein genetischer Defekt in meinem Gehirn, erklärte mir später der tatsächlich witzige, weil ohne Zynismen auskommende, zudem offenbar etwas mehr wissende und weniger ahnende Chefarzt, habe sich gut über fünfzig Jahre Zeit gelassen, mein Oberstübchen ins Chaos zu stürzen und mir dabei gar kurzzeitig gänzlich das Licht ausgeknipst; was mir zu jenseitigen Erfahrungen, manch einer nennt das Transzendenz, verholfen hat. Es folgten einige Wochen Klinikaufenthalt mit anschließendem Flug zur Hotelkur im Murnau des Blauen Reiters, das sich mir Liebhaber bestimmter Kitschvarianten zuliebe auch noch völlig einschneien ließ.
Der Gehirnspezialist mit Vollausstattung in kunstumwehter Praxis in bester Lage, dem ich mich auf Empfehlung (s)eines Kollegen für kaputte Hälse, Nasen, Ohren zur Überwachung meiner in Unordnung geratenen Ganglien anvertraute, schaffte es dann allerdings, den wiederlangten Glauben an die göttlichen Weißkittel wieder zunichte zu machen. Er ließ mich Medikamente einnehmen, die in der verabreichten Kombination zu temporären Depressionen führten, begleitet von heftigen Schüttelanfällen einzelner Gliedmaßen, die sich als Symptome Parkinsonscher Krankheit bemerkbar machten. Diese Diagnose stellte allerdings nicht er, sondern mein alteingesessener Hausapotheker kam darauf, als er die Verträglichkeit der mir verordneten Medikamente prüfte. Bereits auf den Beipackzetteln wurde davor gewarnt, das eine mit dem anderen Präparat zu kombinieren. Bestätigt wurde dieser Verdacht nach Telephonaten meines liebsten pharmazeutischen Drogenhändlers mit den Herstellern.
Nun gut, sie sind nicht alle so (un)fähig. Das weiß ich. Manch eine(r), vielleicht besser: ein paar wenige haben auch heute mein uneingeschränktes Vertrauen; was jedoch auch an freundschaftlicher Verbundenheit liegen kann, die zwischen Arzt und Patient mehr Zeit mitbringt. Und die Zweiklassengesellschaft der Krankenversorgung ist mir sehr wohl bekannt, beinahe täglich wird mir davon berichet. Entgegen den Verlautbarungen vieler Politiker existiert sie. Ich kenne die ärztliche Formulierung des Arztes am Telephon, der den Kollegen wegen einer dringenden Überweisung sagt: «Er ist ein Lieber.» Das ist der verbale Schlüssel zum Schnelleintritt in eine weitere Untersuchungsstation, während der Nichtliebe wochen-, oft genug monatelang wartet. Aber das Phänomen schludriger bis unverantwortlicher, möglicherweise unzureichend ausgebildeter Mediziner ist kein neues. Denn wenn ich zurückdenke, war alles noch viel schlimmer, genauer betrachtet war das da oben lediglich eine Skizze für eine lange Erzählung mit dem Schluß: Ins Krankenhaus? Nur über meine Leiche. Deshalb oder auch dennoch kann ich den eingangs per Link erwähnten Ärger nur zu gut nachvollziehen.
| Do, 03.06.2010 | link | (4842) | 22 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |
Jean Stubenzweig motzt hier seit 6263 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00
... Aktuelle Seite
... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)
... Themen
... Impressum
... täglich
... Das Wetter
... Blogger.de
... Spenden
Zum Kommentieren bitte anmelden.
Suche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
AnderenortsSuche:
Letzte Kommentare:
/
Echt jetzt, geht noch?
(einemaria)
/
Migräne
(julians)
/
Oder etwa nicht?
(jagothello)
/
Und last but not least ......
(einemaria)
/
und eigentlich,
(einemaria)
/
Der gute Hades
(einemaria)
/
Aus der Alten Welt
(jean stubenzweig)
/
Bordeaux
(jean stubenzweig)
/
Nicht mal die Hölle ist...
(einemaria)
/
Ach,
(if bergher)
/
Ahoi!
(jean stubenzweig)
/
Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.
(einemaria)
/
Sechs mal sechs
(jean stubenzweig)
/
Küstennebel
(if bergher)
/
Stümperhafter Kolonialismus
(if bergher)
/
Mir fehlen die Worte
(jean stubenzweig)
/
Wer wird schon wissen,
(jean stubenzweig)
/
Die Reste von Griechenland
(if bergher)
/
Richtig, keine Vorhänge,
(jean stubenzweig)
/
Die kleine Schwester
(prieditis)
/
Inselsommer
(jean stubenzweig)
/
An einem derart vom Nichts
(jean stubenzweig)
/
Schosseh und Portmoneh
(if bergher)
/
Mit Joseph Roth
(jean stubenzweig)
/
Vielleicht
(jagothello)
«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»
Suche:
Andere Worte
Anderswo
Beobachtung
Cinèmatographisches + und TV
Fundsachen und Liebhaberstücke
Kunst kommt von Kunst
La Musica
Regales Leben
Das Ende
© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig
